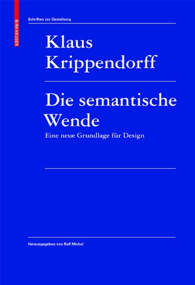1 Menschen-bezogenes Design
Im zweiten Kapitel geht es um die Grundbegriffe eines »human-centered design« in Abgrenzung zum industriezeitlichen technologiegetriebenen Design. Umfassend setzt sich der Autor hierfür zunächst mit den Wegbereitern seines Denkens und früheren Verfechtern semantischer Ansätze auseinander. Ein Streifzug durch die Historie verschiedenster Disziplinen, insbesondere der Philosophie, spannt den Bogen von den Ansätzen des griechischen Philosophen Protagoras über die Theorien Humberto Maturanas, Francisco Varelas sowie René Descartes‹, Benjamin Lee Whorfs und Edward Sapirs hin zu den sprachphilosophischen Überlegungen Ludwig Wittgensteins. Der Leser muss dabei keine Angst haben, sich in philosophischen Theorien zu verlieren, dank der äußerst klaren, sachlichen Präsentation der einzelnen Ansätze und vor allem auch wegen der scharfsinnigen Einflechtungen dieser untereinander und in den Gesamtentwurf der Designtheorie wird einem die Lektüre zwar nicht unbedingt mühelos, doch aber äußerst angenehm und sogar fesselnd gestaltet. Wittgensteins Erkenntnis über die Abhängigkeit der Sprache von ihrem Gebrauch im sozialen Kontext als auch die Situationsbedingtheit der Bedeutung von Sprache stellen sich schließlich als die wichtigsten Eckpfeiler der Theorie des menschenbezogenen Designs heraus (vgl. S. 71). Mit Wittgenstein wendet sich Krippendorff denn auch gegen die metaphysisch-dogmatischen Bestrebungen des an Universalität interessierten technologischen Designs, und optiert für das Bemühen um Detail und Einzigartigkeit in der Gestaltung (vgl. S. 72).
Der Designer ist nach Krippendorff eine Art Allrounder, der per se ein hohes Maß an Menschenbezogenheit aufweist, da es ihm vor allem darum gehen muss, die Lebensweise möglichst vieler Menschen durch den Umgang mit Artefakten zu verbessern, indem er sich um eine verantwortungsvolle Beziehung zwischen Mensch und Technologie kümmert. Leider, so die Bestandsaufnahme des Autors, hat gerade dieses Maß an Menschenbezogenheit nicht davor bewahrt, dass der Designer nur all zu häufig ins Hintertreffen der Diskurse geraten ist, sofern nämlich seine Erfolge nicht ebenso vorhersagbar, seine Methoden weniger erklärbar und seine Kriterien weniger durchsichtig sind als die anderer Disziplinen und Diskurse. In Anerkennung der Bedeutung soll der Designdiskurs nun ein rhetorisches Gewicht gegenüber anderen Diskursen gewinnen, der Designer sozusagen sein eigenes Kriterium der Rechtfertigung erhalten, das ein ganzes begriffliches Werkzeug zur schärferen Argumentation umfasst. Bedeutung selbst ist dabei zunächst definiert als etwas, das all jenen mannigfaltigen Rollen entspricht, die ein Artefakt in einem Diskurs potentiell spielen kann, sie beruht zunächst auf dem Prinzip des Sinns, was die Anerkennung alternativer Sicht- und Handlungsweisen impliziert und ist streng nach Wittgenstein vom Kontext der Verwendung jeweiliger Artefakte abhängig (vgl. S. 93).
Eine solche Form der Anerkennung fordert die semantische Wende mit besonderem Nachdruck vom Designer mit Blick auf »Stakeholder« des Designs ein, damit sind alle von Design Betroffenen und an ihm und seiner Umsetzung interessierten Personen gemeint (vgl. S. 95), nicht alleine nur der Endnutzer. Überzeugungen und Wirklichkeitskonzepte dieser »Stakeholder« müssen bei Designern Berücksichtigung finden. Ihre Reflexivität impliziert deshalb zwei Verstehensmomente: einerseits das des Designers gegenüber dem von ihm vorgeschlagenen Artefakt und zweitens das Verständnis für das Verstehen der »Stakeholder« hinsichtlich des Artefakts. Weil das human-centered design Artefakte für andere entwirft, muss es sozusagen eine Art Verstehen zweiter Ordnung beinhalten. Methodisch gilt es für den Designer hierbei Bedeutungen hinsichtlich von Artefaktbezügen zu erfragen und diese mit seinen eigenen Vorstellungen abzugleichen. Somit setzt ein menschen-bezogenes Design eine mindestens dialogische Kommunikation voraus. Qua Diskurs schafft es die Designsemantik Brücken zu schlagen (vgl. S. 97ff.) und mit den metaphysischen Grundannahmen eines herkömmlichen Verstehens erster Ordnung zu brechen; »Stakeholder« werden nicht in kausalen Zusammenhängen als Mechanismen begriffen, die einfach nur auf Stimuli reagieren, sondern als in ihren Handlungen und in ihrem Verstehen ernstzunehmende Akteure, die ihre eigenen Tatsachen schaffen. Krippendorffs Perspektive mag zunächst aus Sicht des Designers weniger attraktiv, wie ein offenes Zugeständnis an die Spielräume von »Stakeholdern« daherkommen. Tatsächlich erhält der Designer keine privilegierte Rolle gegenüber anderen; was ihn jedoch als einzigartig auszeichnet, ist sein besonderes Verständnis und der Respekt vor dem Lebensentwurf des jeweils anderen. Es ist Krippendorff hoch anzurechnen, dass er die Verantwortlichkeit gegenüber Dritten in die Verantwortung des Designers gegenüber sich selbst miteinbezieht und diese zu einem zentralen Aspekt seiner allgemeinen Theorie des Designs macht. Denn eine fortgeschrittene Designkultur erwartet von einem guten Designer, dass er die Optionen für »Stakeholder« nicht einfach umsetzt, sondern diese erweitert. Das ist nur möglich, wenn »Stakeholder« in ihren Überzeugungen und Bedeutungszuschreibungen in den Designprozess angemessen integriert werden und Designentscheidungen an diese delegiert werden, was den modernen Designer zwangsläufig in der Weitsicht seiner Umsetzungskompetenz herausfordert.
Ausgabe Nr. 4, Frühjahr 2014