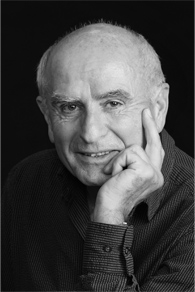Designideen, die sich zu weit, und das heißt für die Adressaten unvermittelbar vom Gemeinsinn, entfernen, scheitern – freilich nicht notwendigerweise auf Dauer. Wenn es gelingt, den Vorstoß ins Unbekannte, Unvertraute, Anstößige nachträglich durch Zwischenformen zu vermitteln, so kann das in der unvermittelten Präsentation erfolglose Figuren-Konzept noch zum Erfolg führen.
Allgemein gilt die rhetorische Devise, dass der kontrollierte Verstoß, das gut ausgesteuerte Befremden, die Überraschung eine Wirkung verstärken und dauerhafter machen. Sie wirken dem Überdruss am Abgegriffenen, Verschlissenen entgegen. Auch kein Kunstwerk ist gegen diesen Effekt gefeit. Wer sieht noch wirklich den Blick der Putten in Raffaels »Sixtinischer Madonna«, das Lächeln der Mona Lisa oder der Venus von Botticelli – man kann sie eben im übertragenen wie im buchstäblichen Sinne »nicht mehr sehen«, weil die massenhafte Reproduktion, die stereotype Übertragung auf Wäsche, Bekleidung, Plakatwände sie um ihre sinnliche Überzeugungskraft gebracht hat. Sie sind trivial geworden, unfähig, unsere Sinne zu affizieren. Visuelle als an die sinnliche Vor- stellung und Empfindung adressierte Phänomene sind der Trivialisierung stärker ausgesetzt als ihre sprachlichen Pendants, insofern auch die geronnene Metapher – ja gerade sie – intellektuelle Wirksamkeit (also auf argumentative Weise) entfalten kann. Die zum Klischee erstarrte Figur erweckt nichts anderes als Überdruss und kann neue Bedeutsamkeit nur durch einen anderen, zum Beispiel einen kritisch-analytischen, Zugriff erfahren.
8. Ohne diese uns allen geläufige Erfahrung zu vertiefen, bleibt zu resümieren, dass die Designtheorie die besondere Verschleißanfälligkeit des Bildes schon immer in ihre Konzepte aufzunehmen hatte. Die Fruchtbarkeit rhetorischer Erbschaft erweist sich auch von dieser Seite, insofern Wirkungsintentionalität für die Rhetorik nicht eine Forderung unter anderen, sondern das Basisprinzip ist – und zwar produktionstheoretisch wie hermeneutisch –, die Wirkung also durch Gewohnheit abgeschwächt, sogar verhindert werden kann. Denn Rhetorik bewirkt nicht nur die Sicherung des Konsenses, sondern ebenso und mit ihm vermittelt auch die Sicherung des Widerspruchs, der Verfremdung, des Neuen. Ihr Wesen ist dialektisch: Affirmation und Negation in einem. Formen, die aus dieser Spannung leben, können zwar veralten, besitzen aber immer das Potenzial zu neuer Wirksamkeit.
[Dieser Essay von Gert Ueding wurde erstmals veröffentlicht in: Joost, Gesche; Scheuermann, Arne (Hg.): Design als Rhetorik: Grundlagen, Positionen, Fallstudien. Basel: Birkhäuser, 2008. S. 81–88.]

Illustration: Thilo Rothacker
Ausgabe Nr. 1, Herbst 2012