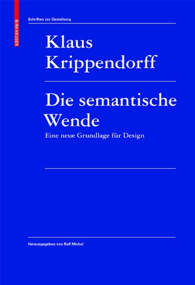Um Kommunikationsprozesse zu verstehen, die Artefakte zum Thema haben, bedarf es daher, wie schon angedeutet wurde, einer dialogischen Theorie der Sprache, deren einzelne Elemente Krippendorff im vierten Kapitel dezidiert darlegt. Wichtige Schlagwörter sind in diesem Zusammenhang die Begriffe Kategorisierung sowie Charaktere. Designer haben demnach darauf zu achten, welche Kategorien Stakeholder und andere innerhalb der Kommunikation über Artefakte anbringen, um Erwartungen abklopfen und abgleichen zu können. Charaktere oder auch Adjektive richten sich gezielt auf bestimmte Qualitäten des Artefakts, in denen dessen Bedeutung zum Ausdruck kommt, wobei Qualitäten gemeint sind, die vor allem soziokulturell abhängige, also wechselbare Qualitätszuschreibungen meinen. Krippendorffs Theorie unterscheidet insgesamt vier Methoden zur Ermittlung von Charakterzügen von Artefakten (vgl. S. 203f.), die vom semantischen Differenzial über die interviewartige Freilegung von Assoziationen und eine Inhaltanalyse bis hin zum Vergleich führen. Ohne an dieser Stelle näher auf die einzelnen Methoden eingehen zu können, möchte ich doch darauf hinweisen, dass Krippendorff hier – in Rücksichtnahme auf die sprachlichen Abhängigkeiten – eine Methodentheorie entwickelt, deren Stärke eindeutig in der toleranzbasierenden Ungezwungenheit ihrer möglichen Umsetzung begründet liegt, sie beschreibt einen zwanglosen Weg zur Quantifizierung von Artefakten und somit ein relevantes Instrument zur Hinterfragung auch bestehender Design-Kriterien und letztlich der qualifizierten Rechtfertigung gegenüber Dritten.
2.3 Die genetische Bedeutung von Artefakten
Im fünften Kapitel geht es Krippendorff darum, Artefakte innerhalb ihres gesamten Lebenszyklus zu berücksichtigen. Seine Ausgangsthese lautet dabei, dass Design immer auf den Erfahrungen vorangegangener Vorschläge und Prozesse aufbaut, sich demzufolge in Transformationen, Übersetzungen, Neu-Artikulationen und Dekonstruktionen manifestiert. Da dies so ist, folgert er weiterhin, dass Design all jene Prozesse, von denen es unweigerlich ein Teil ist, auch untersuchen und begreifen muss, um seine Prozesse letztlich mit zu beeinflussen (vgl. S. 226). Der Lebenszyklus eines Artefakts wird als durchaus komplex und der Möglichkeit nach nicht endlich beschrieben, er fängt etwa beim Designentwurf an, schließt die Beteiligung von Ingenieuren (Produktionszeichnung), Herstellern, Marktforschern, Betriebswirtschaftlern, Werbern, Verkäufern, Kunden und vielen mehr mit ein (vgl. S. 229). Um seine Design-Projekte zu realisieren ist der Designer also rückgebunden an ganze »Stakeholder«-Netzwerke. Der Netzwerkbegriff soll hierbei spezifisch darauf eingehen, dass sich »Stakeholder« oft verschiedentlich auf Manifestationen eines Artefakts in seinem Zyklus kaprizieren. Für den Designer liest sich dies wiederum als Anforderung, sich gut hinsichtlich der Abhängigkeiten in »Stakeholder«-Netzwerken zu informieren. Krippendorff führt hierfür eine Analyse der Merkmale von »Stakeholdern« an (vgl. S. 231f.), die es zu berücksichtigen gilt. Das Einbinden der »Stakeholder« in ihrer Unterschiedlichkeit bedeutet das Gewinnen von Ressourcen und dies wiederum erfolgreiche Designprojekte. Artefakte sind also nur realisierbar, wenn sie für alle bedeutungsvoll sind, die sie durch ihre verschiedentlichen Manifestationen führen (vgl. S. 237); dies zu gewährleisten und Bedeutungen zu ermöglichen, ist Aufgabe des postindustriellen Designers.
2.4 Die ökologische Bedeutung der technologischen Artefakte einer Kultur
Für den Designer ist es letztendlich auch relevant, die ökologischen Zusammenhänge zu verstehen, mit denen ein Design konfrontiert wird. Eine Ökologie der Artefakte besagt dabei, dass Artefakte wie biologische Spezies untereinander interagieren. Allerdings sind es nicht die Artefakte selbst, sondern die Menschen, die ihre Zusammenhänge bestimmen, und zwar innerhalb der kollektiven Umsetzung einer Vielzahl von lokalen ökologischen Verständnissen (vgl. S. 248). Das Kapitel handelt also im Wesentlichen davon, dass diese ökologischen Interaktionen, zumindest der Möglichkeit nach, durchschaut werden sollten, denn jedes gute innovative Design muss, um in seinem zuvor angesprochenen Lebenszyklus nicht zu scheitern, auch die bestehenden ökologischen Stabilitäten herausfordern und Möglichkeiten für modifiziertes, neuartiges Design bereitstellen. Krippendorff analysiert hierfür ökologische Wechselwirkungen, wie Bedeutung im ökologischen Kontext entsteht im Hinblick auf vor allem zwei Erklärungsansätze: einer diachronen und einer synchronen Verständnisweise, die sich beide weiter spezifizieren und erweitern lassen. Es erscheint dabei evident, dass Designer lernen müssen, auch die ökologischen Bedeutungen ihrer Entwürfe abzuklopfen, da sie nur so das höhere Potential gewinnen können, ihr Design am Leben zu halten (vgl. S. 255).
Ausgabe Nr. 4, Frühjahr 2014