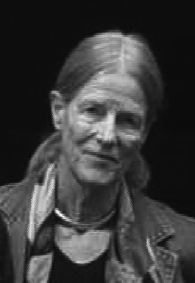Petrarcas Blicken erschloss sich dagegen eine ganz andere Dimension. Weder von territorialen Ansprüchen noch von praktischen Zwecken überhaupt geleitet, konstituierten sie einen neuen, von funktionalen Bestimmungen entbundenen räumlichen Zusammenhang. Darin erweist sich Petrarca bekanntlich als einer der »frühesten völlig modernen Menschen« – wie ihn Jakob Burckhardt nannte –, dass er den vor ihm sich öffnenden irdischen Raum unabhängig von dessen Nutzbarkeit in seiner ästhetischen Qualität und damit erst in seiner Bedeutung als »Landschaft« wahrnahm.
Wie neuartig diese Betrachtung der umgebenden Welt seinerzeit war, zeigt Petrarcas Bestürzung über die zur Besinnung auf die menschliche Seele mahnenden Worte Augustins, die er angesichts von alledem, was er »eins ums andere bestaunte«, in den mitgeführten Bekenntnissen gelesen hatte: »Ich war wie betäubt … und schloss das Buch im Zorn mit mir selbst darüber, dass ich noch jetzt Irdisches bewunderte.« Reumütig kehrte er um: »Da beschied ich mich, genug von dem Berge gesehen zu haben, und wandte das innere Auge auf mich selbst.«[6]
Die gegenüber dem Alltagsbewusstsein erweiterte ästhetische Wahrnehmung, damals schockartig ausgelöst durch Entgrenzung, Überschreitung des eng Zweckmäßigen, bestimmt bis heute das Landschaftssehen, das sich im Rahmen des Horizonts vollendet. Als wesentliches Moment der Raumwahrnehmung trennt der Horizont nicht nur Himmel und Erde, oben und unten; er setzt auch Nähe und Ferne und den Ausschnitt der Wahrnehmung, der sich in seinem Rahmen zum Totaleindruck einer Landschaft zusammenschließt. Ein Ganzes, das als solches allerdings nur dem totalisierenden und raumkonstituierenden Blick selbst entspringt. Im Zentrum der Landschaft steht das Individuum, das sich in Beziehung zu seiner Umgebung setzt. Das Ich, zum Subjekt geworden, sieht sich jedoch in der ästhetischen Betrachtung nicht einfach einer Objektwelt gegenüber, die am Horizont ihre augenblickliche Grenze erreicht. Es wird seinerseits von ihr berührt und angeregt.
Durchlässig nur für Spekulationen, stellt sich der Horizont dem ruhenden Betrachter unüberwindbar entgegen, hält seine Stellung jedoch nicht gegen die Bewegung. Vor den Blicken beim Abstieg erheben sich Hügel, die man von der Anhöhe in ihren flach gewellten Konturen wahrgenommen hatte, zu immer höheren Barrieren. Im Ansteigen zeigen sich hinter den Dingen andere Dinge und hinter den anderen Dingen wieder andere Dinge und so fort.
Ausgabe Nr. 2, Frühjahr 2013