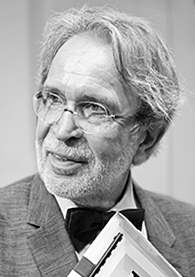Welche Frage wollten Sie schon immer einmal beantworten, die Ihnen nie gestellt worden sind?
Warum mache ich so ein Interview? Um das zu sagen, was ich weiß? Das kann es ja nicht sein. Sondern um herauszubekommen, was Ihr Interesse an der Zukunft der Arbeit ist und warum Sie sich dafür interessieren. Will man damit die Zukunft bändigen? Soll das Unsicherheiten reduzieren, handelt es sich um Flucht, oder soll das wirklich Innovation bahnen? Das Gequassel über die Zukunft ist die Unfähigkeit, mit der momentanen Komplexität umgehen zu können. Deshalb glauben wir, uns mit der Zukunft beschäftigen zu müssen, denn dann könnte das ja alles noch Sinn ergeben, was wir an der momentanen Situation vermeintlich nicht ändern können. Es ist Umgang mit Unsicherheit. Die Zukunft wird das schlucken, sie wird nicht (nur) durch Prognosen gestaltet, sondern durch Erfolge, Misserfolge, Störungen, Fehler und Irrtümer. Wir sind die Gestaltenden der Gegenwart, und diese zeigt, welche Vergangenheit wir verändert haben. Das sollte eigentlich auch stärker in Zukunftsszenarien gemacht werden. Ich habe Zukunftswerkstätten im Sinne von Robert Jungk erlebt und veranstaltet. Dabei betrachteten wir immer Ist- und Soll-Zustände, und es ist klar: Wenn wir einen Soll-Wert aufstellen, sprechen wir von der Zukunft. Für eine Zukunftswerksatt war es primär wichtig festzuhalten, wie die Arbeitsplätze heute sind, und dann erst stellt sich die Frage, wie sie sein könnten. Dazu braucht es Fantasie, sich vom Ist zu lösen, um im Soll etwas Neues aufscheinen zu lassen. Anschließend stellt sich eine Zukunftswerkstatt die Frage, was sich, wenn der Soll-Zustand erreicht ist, erwartungsgemäß verändert haben wird ‚und als letzter Schritt, wo man heute anfangen könnte, dem Soll-Wert näher zu kommen. Vieles von dem was vermeintlich in einer fernen Zukunft liegt, ist damit eine Gegenwartsaufgabe. Ich kann heute damit anfangen: Indem ich die Gegenwart aus einer solchen Soll-Ist-Differenz heraus bearbeite, mache ich Zukunft, und zwar direkt in der Gegenwart. Das beinhaltet der Begriff der »Vergegenkunft«.