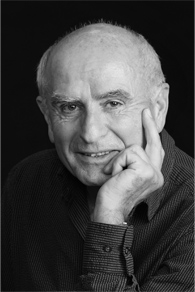Ob wir in diesem Punkt zu einer abschließenden Klärung kommen können, sei dahingestellt. Für mein Thema wichtig bleibt, dass auch der rhetorische Argumentationstheoretiker Aristoteles die Gefühlsgründe nicht einfach wie sein Lehrer Platon als böse, als Gebrechen und Makel des Menschen geißelt, sondern in sein Bildungsprogramm aufnimmt. Was ihm umso besser gelingt, als er die Gefühle eben nicht als bare Irratio verteufelt. Versteht er doch unter »Pathos« eine zielgerichtete Gemütsbewegung, die von Lust- oder Unlustempfindungen begleitet wird, aber, anders als die bloß tierische Begierde, von rationaler Überlegung nicht vollkommen getrennt ist. Der Mensch nämlich reagiert mit seinen emotionalen Gemütsbewegungen nicht bloß zwanghaft infolge seiner Sinneseindrücke, sondern ebenso aufgrund einer, von seinen Bestrebungen aktivierten vorgängig eingenommenen Stellung zu dem vorliegenden Sachverhalt – einer Konditionierung also, die durch mehrfache Erfahrung und Überlegung zustande gekommen ist, also alles andere als irrational, wenn auch fehlbar. Und es ist wahr: Auf den Anblick eines Ferienplakats mit Sonne, Strand und Meer oder einem entsprechenden Gebirgspanorama reagieren wir mit Sehnsucht, Wohlgefühl, Heiterkeit, froher Erwartung – je nachdem. Das heißt, wir antworten gefühlshaft und spontan, aber aufgrund der längst habitualisierten Annahme, dass dieses Sujet für uns mit Lust und Entspannung verbunden ist. Die Gewöhnung bringt in den wilden Affekt nicht bloß ein reflexives Element hinein, sie verändert ihn auch. In dieser neuen Gestalt erst wird er rhetorisch überzeugungskräftig. Mit den Worten der »Nikomachischen Ethik«: Ganz allgemein scheint die Leidenschaft nicht dem Wort zu weichen, sondern nur der Gewalt. Es muss also der Charakter schon in gewisser Weise zuvor der Tugend verwandt sein, das Schöne lieben und das Schimpfliche verabscheuen.«
Die gegensätzliche Zuordnung der Affekte in diesem Beispiel ist nicht zufällig, sondern macht auf die Bandbreite von Gefühlsdispositionen aufmerksam, deren Extreme sie jeweils bezeichnen. Unsere metaphorische Redeweise, dass etwa Liebe in Hass »umschlägt« oder Furcht in den »Mut der Verzweiflung« entspricht der Dynamik unseres Gefühlslebens selber. Weshalb Aristoteles die Affekte in seiner »Rhetorik« in antithetischer Ordnung, als die ihnen selber innewohnende, abhandeln kann: also Zorn und Sanftmut, Liebe und Hass, Furcht und Mut usw. Es gibt auch einen praktischen Grund in der Redesituation selber. Der Umgang mit den Affekten geschieht rhetorisch auf zweifache Weise: erstens durch Moderierung auf ein ausgeglichenes Maß auf dem Wege der Gewöhnung, die aber einen kontinuierlichen Einfluss in einem langen Bildungsprozeß verlangt, also der rhetorischen Erziehung und dem langwährenden rednerischen Einflusses auf das Publikum vorbehalten ist. Zweitens aber, und das verlangt die jeweils aktuelle rhetorische Situation, die immer ein auch in dieser Hinsicht gemischtes Publikum vorfindet, soll der Redner auf eine Affektrede durch den Einsatz des Gegenaffekts antworten können. Ich gebrauche das Wort mit Bedacht: Affekte antworten einander im Sinne der Extreme, die sich, so verschieden sie sind, doch »berühren«, was ja nichts anderes heißt, als dass sie nicht beziehungslos neben- oder untereinander stehen, sondern – ich gebrauche den Vergleich mit Absicht – »sich etwas zu sagen haben«, weil sie die gleiche Sprache sprechen. Es ist eine dialektische Perspektive, in der, so betrachtet, die Affekte in der Rhetorik thematisch werden, und die dem Konzept einer bloß monologischen Gewalt der Affekte ein anderes Konzept entgegensetzt. Der Gewalt kann man widerstehen (das stoische Konzept) oder sich fügen im Sinne diktatorischer Unterwerfung oder drogenähnlicher Verführung (das demagogische Konzept). Wenn die Affekte freilich selber in Wechselwirkung miteinander gebracht werden, weil sie potenziell dazu fähig sind, eröffnet sich eine dritte Zugangsweise, die sich in das dialogische Konzept der Rede einfügt, ja – zu seinem Bestandteil wird. Wie in diesem Konzept der Redner Mitzuhörer und der Hörer Mitredner ist, so wird das Publikum auch in der Gefühlsrede nicht als bloßes Opfer von Überredung, sondern als gleichberechtigter Partner selbst in der Gegnerschaft begriffen. So herrscht die dialogische Struktur nicht bloß innerhalb der Rede selber im Widerstreit der Affekte, sondern auch im Verhältnis des Redners zum Publikum, beruhend auf der prinzipiellen »Ansprechbarkeit« des Menschen auf der Ebene seiner Gefühle. Wobei eine Voraussetzung in dieses Konzept eingeht, die nicht selbstverständlich ist: dass nämlich der Redner selber jenen Bildungsprozess durchlaufen hat, von dem Aristoteles spricht, also den Adressaten, sein Publikum nicht nur als Manövriermasse seiner Absichten begreift und zum Raub seiner eigenen Affekte macht. Mit Gefühlen kann man ebenso manipulieren wie mit Zahlen und Argumenten. Die einzige rhetorische Versicherung dagegen bietet die Rede als Gespräch, weil Widerspruch Prinzip des Dialogs, nicht sein Beiwerk ist. Nehmen wir alles in allem, so bleibt ein geläufiges Urteil über den aristotelischen Redner, er sei das Subjekt, der Hörer aber bloß »das Objekt des auszulösenden Affektes« an der Oberfläche von Bemerkungen zur Wirkungsweise affektischer Rede. Die Affekte sind für den Autor der »Nikomachischen Ethik« ebenso wie für den der »Rhetorik« Modi des zueinander Redens durch den Ausdruck davon, wie wir zueinander stehen: wir haben es auch bei den Gefühlen mit Relationsverhältnissen zu tun, spannungsvoll und zu Ausbrüchen geneigt, doch voll indirekter Mitteilungen über alle Faktoren, die am Redegeschehen beteiligt sind, die objektiven ebenso wie die subjektiven.
Doch zurück zur Genealogie der Affektrede, die in der römischen Rhetorik eine eigene Richtung bekommt, die zwar keine Abkehr, aber doch eine Änderung bedeutet. Werfen wir einen Blick in Ciceros »De oratore«. Dort findet sich im 1. Buch eine an Aristoteles anschließende, aber in der angedeuteten Hierarchie auch von ihm sich schon etwas entfernende Erläuterung der officia des Redners: »Es ist nämlich nötig, dass man sich eine umfassende Sachkenntnis aneigne, ohne welche die Geläufigkeit der Worte nichtig und lächerlich ist, dass man den Vortrag selbst nicht allein durch die Wahl, sondern auch durch die Anordnung der Worte passend gestalte, daß man alle Gemütsbewegungen, welche die Natur dem Menschengeschlecht erteilt hat, gründlich erforsche, weil die ganze Kraft und Kunst der Rede (!) sich in der Beruhigung oder Aufregung der Gemüter unserer Zuhörer zeigen muß. Hinzutreten muß gleichfalls eine Art des Witzes und der Laune, eine des freien Mannes würdige Gelehrsamkeit, Schlagfertigkeit und Kürze im Antworten und Herausfordern, verbunden mit feiner Anmut und feinem Geschmack.«
Die »Beruhigung oder Aufregung der Gemüter« wird an dieser Stelle von Cicero noch nicht weiter differenziert. Wichtig ist die Charakterisierung der Redekunst nach einer Rangfolge der Überzeugungsmittel. An anderer Stelle bekräftigt Cicero sie, und zwar noch durchaus nach dem Maßstab der Sachangemessenheit: »So konzentriert sich die gesamte Redekunst auf drei Faktoren, die der Überzeugung dienen: den Beweis der Wahrheit dessen, was wir vertreten, den Gewinn der Sympathie unseres Publikums und die Beeinflußung seiner Gefühle im Sinne dessen, was der Fall (!) jeweils erfordert.«