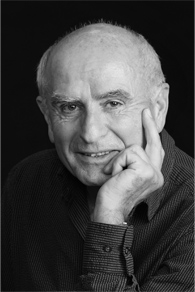Anders als seine Vorredner und Vordenker setzt Cicero nicht auf eine Kultivierung der Affekte, auf ihre Interaktion mit den vernünftigen Vermögen und die ihnen eigne dialektische Selbstentfaltung, sondern auf moralische Erziehung, auf die »auctoritas« des »orator perfectus«, der Weisheit (»sapientia«), Wissen um das rechte Maß (»moderatio«) und moralische Tugend (»virtus») vereinigt. Wenn auch für die römischen Verhältnisse viel zu schwach, hatten die Vorkehrungen Ciceros gegen den Mißbrauch der Affektrede doch noch einen in seinen europäischen Wirkungen kaum zu überschätzenden Überschuss. Er begründete die alle ständischen Unterschiede nivellierende Ideologie der »Humanitas« als neues Prinzip dessen, was wir dem Menschen als Menschen schuldig sind, es ist der tiefe und leidenschaftliche Anteil, der den jungen Cicero ausdrücklich in seinen ersten Gerichtsreden bewegte. »Hier erschließt sich«, resümiert Rudolf Schottländer, »im Kontrast zu der vollen Justizbestialität der Anklage, gleichsam eine neue Dimension der ›humanitas‹. Sie wird zu einer Idee, die hochgehalten und realisiert werden muß durch das persönliche und öffentliche Eintreten für Schutzbedürftige. Diese Art von Mitmenschlichkeit ist mehr als das liebenswürdige, freigebige, mitleidige Sympathisieren des ›philanthropos‹ im griechischen Sinne.« Es ist, um das zu ergänzen, ein aufs Höchste affekthaft aufgeladenes Ideal kämpferischer, völlig unerbaulicher Mitmenschlichkeit.
Keinerlei Rolle spielt es in der nächsten Station der Geschichte rhetorischer Affektenlehre, auf die ich nur einen Seitenblick werfe, weil sie nur eine Tendenz, über die ich schon sprach, verstärkte. Ich meine die – eine lange Zeit Cassius Longinus, einem Redner des 3. Jahrhunderts n. Chr. zugeschriebenen – Rhetorik mit dem Titel »Peri hypsous«, »Über die Höhe« oder gängiger »Über das Erhabene«. Die Ästhetik hat sich ihrer später auf fragwürdige Weise bemächtigt. Die anonyme Schrift beginnt mit einer Kritik am Verfall gerade der erhabenen Beredsamkeit ihrer Zeit zum Schwulst. Kraft und Begeisterung seien Naturgaben, betont der Verfasser, in charakterlicher Größe und dem Verlangen nach Grenzüberschreitung müssen sie ihren Ursprung haben. Bewunderung und Erstaunen gelten ihm als die einzigen wahren Wirkungsintentionen der erhabenen Rede, und sie werden besonders eindrücklich und erfolgreich durch das überraschende, das plötzlich hereinbrechende Unerwartete und Außergewöhnliche erregt. Wörtlich: »Das Erhabene ist der Widerhall einer großen Seele«, es grenzt an das Göttliche, in ihm erleben wir »Höhepunkt und Gipfel der Rede«.
Das sind der Sache und vielfach auch der Formulierung nach längst, spätestens seit Cicero, bekannte Auszeichnungen, sogar die Naturbilder, mit denen Pseudo-Longin seine Rhetorik der erhabenen Rede illustriert, finden sich in der römischen Literatur vorgeprägt. Die begrifflichen Ableitungen gerade vom genus grande waren ästhetisch außerordentlich fruchtbar, wenn wir an die Entwicklung der Gefühlsästhetik im 18. Jahrhundert (Dubos) oder etwa an die Lehre vom unbewußt wie die Natur schaffenden Genie denken. Klaus Dockhorn hat den Einfluß der Rhetorik auf diese Theorien vor mehr als 60 Jahren erstmals in den Hauptzügen dargestellt und die rhetorische Geschichte der Affekte von dem, wie er es nannte, Grunddispositionsschema »logos – ethos – pathos« aus verfolgt. Die Rehabilitierung und wegweisende Erneuerung rhetorischer Forschung, die er bewirkte, erweist sich freilich in zwei Punkten trotz des großen Verdienstes als fragwürdig. Denn erstens richtete sich Dockhorns Interesse fast ausschließlich auf die ästhetische Diskussion, sie berücksichtigte weder die anthropologische, noch die affekttheoretische oder gar politische Dimension des Themas. Und zweitens erscheint mir seine Eingliederung der rhetorischen Affektenlehre in einen »vorromantischen Irrationalismus« (so programmatisch im Untertitel seiner Schrift) ganz gegenläufig zu den Konzepten der klassischen Theorien. Zumal im Hintergrund dieser These wohl die bereits irrationalistisch verkommene Lebensphilosophie der Jahrhundertwende steht – jedenfalls hat sich Dockhorn von einem ihrer Hauptvertreter, nämlich von Alfred Bäumler, anregen lassen.
Um mit der Zuschreibung der Rhetorik zum Irrationalismus zu beginnen, so konzentrierte Dockhorn seinen sehr bescheiden selber so genannten »kurze(n) und grobe(n) Entwurf einer rhetorischen Ästhetik« auf einen Rhetorik-Begriff, in dem, so wörtlich, »das Irrationale (…) ihr bewegendes Prinzip« ist. Und das in doppelter Hinsicht: durch die Stellung der Sympathieerregung, die von der »Verläßlichkeit des Redners«, von seinem Ethos also, ausgeht, auf der einen Seite; vor allem aber durch die Dominanz, die der »emotionale(n) Disponierung oder Zubereitung (sic!) des Hörers«, dem Pathos, für dessen Beeinflussung zukommt. Mit dem sachlichen Überzeugen, dem logos oder pragma, zusammengenommen gewinnt Dockhorn das, wie er es nennt, »Wirkungsschema« der Rhetorik, das Instrument für das »pragmatische(…) Gewinnenwollen von Menschen durch Menschen«.