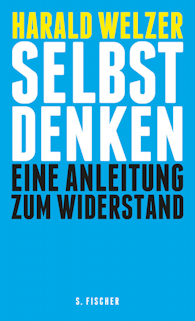Buchbesprechung
»Wohnst du noch, oder zerstörst du schon?«
Harald Welzer plädiert für: »Selbst Denken«
»Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben.« Das sagte Albert Einstein. »Selbst denken. Eine Anleitung zum Widerstand«, widmet sich der Frage wie ein solches Leben aussehen sollte. Harald Welzer beschäftigt sich mit nichts Geringerem als der Gestaltung der Zukunft. Wem jetzt Bilder von neuartigen Interfaces und futuristischen Automobilen in den Kopf schießen, wird jedoch enttäuscht. Nicht das Erscheinungsbild zukünftigen Designs ist Gegenstand des Interesses, sondern der Entwurf eines zukunftsfähigen Gesellschaftsmodells.
Harald Welzer ist Soziologe, Direktor von »Futurzwei - Stiftung Zukunftsfähigkeit« und Professor für Transformationdesign an der Universität Flensburg. Er ist Co-Autor des 2014 im Oekom-Verlag München erschienen Buches »Transformationdesign – Wege in eine zukunftsfähige Moderne«. Die Zukunft ist sozusagen sein Metier.
Die Gesellschaft unseres Typs habe ihre Zukunft verloren, so Welzer, ganz im Gegensatz zu den 1960er-Jahren, als die Zukunft noch als »Labor von Möglichkeiten«(S.10) gegolten habe. Mit diesem deutlichen Statement eröffnet Harald Welzer seine Ausführungen. Angesichts vorherrschender Umweltprobleme – Klimawandel, Atomkraft, Überfischung und Verschmutzung der Meere – und mangelnder Lösungsansätze, scheinen Sorgen durchaus berechtigt. Schonungslos führt Welzer dem Leser diese Probleme und ihre Ursachen vor Augen, um anschließend zu zeigen, wie es künftig besser laufen kann.
Anhand von Beispielen deckt er zukunftsschädliche, wenig nachhaltige Geschäftsmodelle auf. Dem Möbel-Riesen Ikea widmet Welzer sogar ein eigenes Kapitel: »Wohnst du noch, oder zerstörst du schon?«. Denn die kurze Lebensdauer der Produkte und die damit verbundene Ressourcenverschwendung mache das Ikea-Möbel zum Sinnbild der modernen Wegwerfgesellschaft. Energisch hält er dem Leser den Spiegel vor, indem er ihn direkt adressiert – zum Teil sogar provoziert – und erreicht so, dass sich der Leser als Teil des Problems versteht. Jeder ist beides: Geschädigter und Mittäter. Die Tatsache, dass sich der Autor selbst einbezieht, hindert einen jedoch daran, das Buch beleidigt beiseite zu legen.
Darüber hinaus versteht Welzer es, durch die Mischung von wissenschaftlichen Fakten und privaten Anekdoten auch Leser ohne Vorkenntnisse abzuholen. Er veranschaulicht anhand bildhafter Sprache, treffender Vergleiche und eines sarkastischen Untertons, dass der Glaube, heute bereits nachhaltig zu leben, eine Illusion ist. Besonders treffendes Beispiel ist die Kaffeekapsel, die auch in ihrer Ökoversion die Umweltbilanz nicht schönen kann: »Schwupps konnte ein Produkt als umweltfreundlich gelten, das es vor kurzem noch gar nicht gab und das ausschließlich aufgrund seiner Inexistenz umweltfreundlich war«(S.27). So paradox ist sie, unsere Konsumwelt.
Nach einer Vielzahl an Augenöffnern liefert Welzer Beispiele für nachhaltiges Wirtschaften. Er motiviert den Leser, nicht länger Teil des Problems zu sein, sondern Teil der Lösung zu werden. Bestes Mittel dafür sei die Reduktion. Einfacher gesagt als getan, weiß auch der Autor: »Die emotionale Sexyness der Aufforderung ›Lasst uns weniger haben!‹ ist arg begrenzt in einer Kultur, die in jeder Faser auf Expansion geeicht ist«(S.146). Herausforderung sei es deshalb, die Haltung des »Weniger« salonfähig zu machen. Um das zu erreichen ist ein Umdenken unvermeidlich. Dazu gehöre auch, sich die Zukunft als eine »konkrete Utopie« vorzustellen. Sprich: Die Menschen sollten sich lieber ausmalen, wie ihre Zukunft aussehen soll, nicht, wie sie nicht aussehen darf.
Welzers konkrete Utopie zeigt eine Gesellschaft in der es als »cool« gilt »nur noch so viel wie nötig und so wenig wie möglich zu haben«(S.154). Und die Logik ist auf seiner Seite: »Was man nicht hat, braucht keinen Raum, […]kann nicht geklaut werden, […]braucht nicht umziehen, […]kostet nichts«(S.154). Natürlich ist dem renommiertesten Lehrmeister der Republik klar, dass man Menschen nicht durch Belehrungen motiviert, was ihn jedoch nicht an einem Versuch hindert. Immerhin bedürfe es keiner Mehrheiten, um eine Gesellschaft zu verändern, sondern »Minderheiten aus allen relevanten sozialen Schichten«(S.185). Und diesen Minderheiten sei gesagt: »[…] zunächst werden die sogenannten ›first movers‹ als Spinner betrachtet, dann als Avantgarde, dann als Vorbilder«(S.185). Das macht doch Mut. Also worauf warten wir noch? Es ist höchste Zeit für Veränderung.