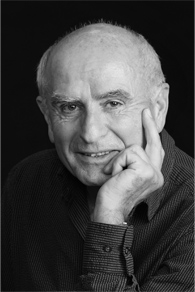Essay
Zur Beredsamkeit der Formen
Anmerkungen zu einer Rhetorik des Designs
1. Das Empfundene wirkt stärker als das Gedachte: diese Erfahrung finden wir schon in den frühen antiken Erkenntnislehren formuliert. Dass nur Gleiches durch Gleiches wahrgenommen werden kann, war die eine Theorie (Empedokles); dass nur Entgegengesetztes das Entgegengesetzte empfinden könne, behauptete eine andere (Anaxagoras). Einig waren sich alle über die Eindrucksmacht der Sinnlichkeit; selbst für Platon stand fest, dass Empfindungen die Gedanken erwecken, sie hervorziehen. Die Bewertungen, die solche Urteile unweigerlich hervorrufen, wechseln freilich von Fall zu Fall. Für die Sensualisten versteht sich die Qualifizierung von selber. Doch auch Kant betont, dass Begriffe, denen wir Realität geben wollen, ohne die Anschauung nicht auskommen; Husserl wird später noch ergänzen, dass »einsichtige Gedanken« Sinnlichkeit benötigen.
Die Rhetorik, die sich in viel engerer Verknüpfung als oft behauptet, und zwar in Zustimmung und Widerspruch, zur Philosophie entwickelt hat, machte sich von Anfang an das durchdringend Wirkungsvolle des sinnlichen Eindrucks zunutze: seit Gorgias und Aristoteles ist die Stärke der Sinnlichkeit die Geburtsstätte der Stil-Lehre und der Theorie von den emotionalen Überzeugungsgründen, den Gefühlsgründen. Das geschah durch Übertragung (eines der grundsätzlichen Verfahren der Rhetorik)[1] der Formen sinnlicher Erfahrung in eine affektische Topik und in die Figuren der Rede.
Möglich war das nur, weil die Empfindungen sich nicht allein in Formen zeigen, die aus dem Augenblick geboren sind und sich nicht wiederholen – ja, dies zum wenigsten. Vielmehr äußern sie sich und wirken mit der gleichen Intensität und Kraft auf einen Formenschatz hin, der dauerhaft ist. Denn Festigkeit und Haltbarkeit müssen hinzukommen. Für sich genommen, löst das anschaulich Gegebene einen Wirrwarr unklarer Empfindungen aus; erst zur Gestalt verfestigt, wird die Eindrucksstärke der Empfindung gezielt gefördert, was sich in Angst oder Hoffnung, Hass oder Liebe niederschlägt. Dies wirkt also so, wie Quintilian, die antike Diskussion zusammenfassend, feststellt: dass »ein Gemälde, ein Werk, das schweigt und immer die gleiche Haltung zeigt, so tief in unsere innersten Gefühle eindringen kann, dass es ist, als überträfe es selbst die Macht des gesprochenen Wortes«.[2] Die sinnliche Figur als Wirkungsschema triumphiert in der Architektur ebenso wie in Gebärdensprache und Physiognomik, in der Wirkungsgeometrie der Ornamente wie in den durch historisch-kulturellen Gebrauch aufgeladenen Grundformen Kreis, Kugel, Dreieck, Quadrat usw. Die Kunst bedient sich seit den Anfängen der empfindungsintensiven Wirkung der sinnlichen Figur, ob sie als Tanzfigur, als Totembild oder Ritualgegenstand zum Bestandteil einer lesbaren Formensprache geworden ist. Niemals freilich erschöpfen sich die Intentionen dieser Formensprache, sobald sie eine bewusst aufgegriffene und verwendete ist, in der l’art-pour-l’art-haften Affekterregung an sich. Die Gebärdensprache des Schamanen, die Tanzschritte des Medizinmannes sind persuasive Formen – nicht weniger als der Handkuss, die Umarmung, der Priestersegen.

Illustration: Thilo Rothacker
- [1] Blumenberg, Hans (1981): Anthropologische Annäherung an die Aktualität der Rhetorik. In: Ders.: Wirklichkeiten, in denen wir leben, Stuttgart: Reclam, vgl. S. 110 ff.
- [2] Marcus Fabius Quintilianus: Institutio oratoria (Ausbildung des Redners). (Herausgegeben und übersetzt von Helmut Rahn, 1998.) Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Buch 11, Kap. 3. 67.