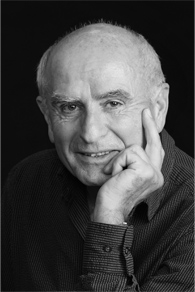2. Formen, ob als Bild oder dreidimensionales Gebilde, haben eine sinnlich-intensive Wirkung; werden sie bewusst hergestellt und eingesetzt, tragen sie eine Wirkungsintention, die einen Adressaten erreichen und ihn beeinflussen soll, sei es im Sinne religiöser Werte, politischer Ideologien oder sozialen Verhaltens. Es gibt auch keine Kunst, die nicht persuasiv wäre, selbst Mondrian wollte mit seinen abstrakt-geometrischen Kompositionen auf die Lebensordnung seiner Adressaten Einfluss nehmen. Wie viel mehr gilt das für die Figurationen unserer Lebenswelt, die ja nicht ein gestaltloses Kontinuum darstellt, sondern in ihren Formen und Figuren immer schon da ist und unser Bewusstsein – als durch die Sinnlichkeit untrennbar mit ihr verbunden – vielfältig beeinflusst. Die Bestrebungen, die man heute unter Design zusammenfasst, bedienen sich auf unterschiedliche Weise dieser Ursprungssphäre der Wirkform. Um das Persuasive, Absichtsvolle der Zweckfigur hervorzuheben, hat man einmal von Kunsthandwerk gesprochen – als ob es eine rein ästhetische, zwecklose und interessefreie Kunst wirklich gäbe. Der einzige belangvolle Unterschied besteht darin, dass der Gegenstand der Formproduktion in dem einen Fall vorgegeben ist, im anderen Fall aus und in der Produktion selber erwächst. Bei näherem Betrachten erweist sich allerdings auch diese Trennung als künstlich und nur aus heuristischen Gründen zu rechtfertigen. Denn ein vierrädriges Gefährt ist schon eine Figur in der technischen Zeichnung oder Skizze, die ihm vorausgeht. Doch ist dieser Grundriss wesentlich an den technischen Erfordernissen ausgerichtet, seine Figur ist rein pragmatisch, und er überzeugt vor allem mit seiner mathematischen, physikalischen Richtigkeit.
Jedenfalls ist das die dominante Wirkungsintention. Dass selbst ihre Dimension der Sachlichkeit, Funktionalität und Redenhaftigkeit von Nebenwirkungen begleitet wird, macht jede technische Zeichnung evident. Die Klarheit geometrischer Formen erweckt Wohlgefallen, weil Reinheit, Offensichtlichkeit, Wahrheit damit verbunden sind.
Hinzu kommen symbolische Bedeutungen mit oftmals affektischen Zusatzwirkungen. Das Rechteck vermittelt Stabilität, Sicherheit, Dauer; der Pfeil Bewegung, Zielgerichtetheit, Augenblicklichkeit. Wenn also der pragmatische Gehalt eines Gegenstandes seine Wirkung niemals total bestimmt, kann man ihn doch als einen idealtypischen Extrempol auf der Skala der möglichen Überzeugungsmittel definieren. Für den Designer gibt demnach das Pragma seines Gegenstandes auch das Programm ab, dem er bei seiner Formproduktion folgen sollte – bei Strafe der »Themaverfehlung«. Aus der pragmatischen Bestimmung eines Autos, sich auf der Erde, auf Straßen, Wegen, Plätzen zu bewegen, ergeben sich schon die Grundzüge eines Formprogramms, in dem zum Beispiel die Räder nicht fehlen dürfen. Doch der Spielraum, der durch technische Zwecksetzung, Funktionalität definiert wird, ist groß, wie ein Blick zum Beispiel in die Formgeschichte des Automobils verrät. Dieser Spielraum gewinnt in dem Augenblick eine besondere Bedeutung, in dem ein Produkt gegen ein anderes antritt, gar mehrere Produkte miteinander um denselben Adressaten konkurrieren, in dem sich also, rhetorisch gesprochen, eine agonale Situation herstellt.
Die rein pragmatische Argumentation reicht nicht mehr aus, um den Streit zu den eigenen Gunsten zu entscheiden. Mag es zunächst noch genügen, durch technische Fortschritte einen Vorsprung zu gewinnen, so verfangen diese doch umso weniger, je vollkommener technisch ausgereift der Gegenstand in allen Varianten ist und/oder je nachrangiger und unbeträchtlicher die neuen Errungenschaften sind. Sofort gewinnen jene Überzeugungsmittel an Gewicht, die bislang die pragmatischen nur begleiteten, bloß auf übertragene Weise mit ihnen zusammenhängen (wie die ausgestellten »Heckflossen« eines Straßenkreuzers) oder sie gar in der Empfindung ersetzen (wie ein Kleid, das nicht mehr die Blöße des Körpers bedeckt und schützt, sondern sie gerade der sexuellen Wirkung wegen ausstellt).
Ausgabe Nr. 1, Herbst 2012