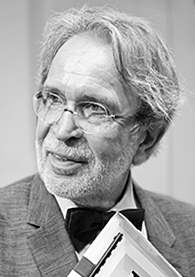Wie kommen Sie darauf, dass sich unserer Arbeitszeit in der Zukunft verkürzen wird?
Um 1850 haben die Menschen bei einer 7-Tage-Woche 82 Stunden gearbeitet. Hundert Jahre später waren es innerhalb von sechs Tagen noch 48 bis 50 Stunden, und heute sind wir in der Schweiz bei 42,5 Stunden pro Woche. Die Jahresarbeitszeit – in der EU zwischen knapp 1400 Stunden pro Jahr in den Niederlanden und gut 2000 Stunden pro Jahr in Rumänien – hat sich über die vergangenen Jahrzehnte in allen Industrieländern also stark reduziert. Gleichzeitig hat jedoch eine Verdichtung stattgefunden. Wir produzierten vor 30 Jahren mit der doppelten Beschäftigtenzahl das gleiche, was wir heute zu produzieren in der Lage sind, und das wird in den kommenden 30 Jahren nicht viel anders sein. Es ist eine gesellschaftliche – und nicht etwa nur eine unternehmerische – Aufgabe, herauszufinden, wie mit diesen Rationalisierungsgewinnen umgegangen werden sollte. Um hierbei gerechte Verteilungsschlüssel zu erarbeiten, wird sich die Trennung zwischen Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft auflösen müssen, und die Stellvertreterpolitik – durch Gewerkschaften etwa – wird ebenfalls durch gesamtgesellschaftliche Forderungen, durch deliberative Demokratie etwa zurück gedrängt. Die beiden jungen englischen Wissenschaftler Osborne und Frey, oder auch die Volkswirte der Bank ING-Diba beschäftigen sich mit diesen Rationalisierungsprozessen und schauen sich an, was in den nächsten drei bis vier Jahren passieren kann: Von den knapp 31 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der BRD können ca. 18 Mio. durch Maschinen oder Software ersetzt werden (in den USA liegt der errechnete Prozentsatz »nur« bei 47 und nicht, wie in der BRD bei geschätzten 59 Prozent)! Von der Modellrechnung her ist das alles gut, realisieren lässt sich das aber nicht ohne Weiteres, da es eine enorme Verunsicherung in allen Ländern mit sich bringen würde. Gerade für Länder mit einer starken Produktion wie Deutschland oder Dienstleistungsanteilen wie der Schweiz, wäre es eine soziale Katastrophe, wenn man das Rationalisierungspotenzial vollständig ausschöpfen würde.
Dabei ist die quantitative Arbeitszeit und deren Reduktion gar nicht das große Problem. Eine Siesta beizubehalten, wäre vielleicht für die Spanier produktiver gewesen, als sie abzuschaffen. Was hat es mit der Trennung von Arbeit und Freizeit auf sich? Was bedeutet Balance bei der Work-Life-Balance? Was will man da eigentlich balancieren? Wenn die Arbeit wirklich gut ist, ist sie nicht Maloche, sondern sinnerfüllendes Tätig-Sein, das nur durch andere Tätigkeiten unterbrochen wird – Kaffee trinken und Plaudern mit einem Freund, in den Urlaub fahren etc. In meinem Berufsleben habe ich Arbeit immer wieder durch Ferien, freie Tage oder freie Stunden im Museum unterbrochen und umgekehrt Ferien oder Museumsbesuche durch Arbeit. Das liegt nicht daran, dass ich ein Workaholic bin; Arbeit ist Habitus geworden im Bourdieuschen Sinne.
Unser Arbeiten hat sich demnach über die letzten Jahrhunderte enorm verändert und wird das auch weiterhin tun. Was wird in Zukunft unsere Motivation sein, zu arbeiten?
Die Arbeitsmotivation ist eine Existenzfrage, und dort, wo es um Existenz geht, spielen meine Wünsche und ureigensten Bedürfnisse eine nachgeordnete Rolle. Übergeordnet ist der Anreiz, der extrinsische Motivator, die Existenz zu sichern. Uns bleibt nun mal nichts anderes, als mit Arbeit das notwendige Einkommen zu sichern, andernfalls werden wir alimentiert. Wir haben in deutschen Abschlussklassen gefragt, was die Schüler werden möchten. Dort gibt es junge Erwachsene, die sagen – und zwar nicht mit feiner Ironie –: »Ich werde ›Hartzer‹. Ich werde keinen Beruf lernen!« Diese Jugendlichen haben bei ihren Eltern miterlebt, wie sie zweimal umgeschult wurden und heute immer noch keine Arbeit haben. Sie werden herausfinden, wie sie innerhalb des Hartz-IV-Systems überleben können. Dadurch bekommen sie eine Grundrente, und alles, was sie zusätzlich machen, geschieht aus Lust und Laune – wenn es noch ein bisschen Geld bringt: um so besser. Wenn man diese Trennung einmal konsequent durchdenkt, dann ist für hochentwickelte Gesellschaften, die enorme Rationalisierungschancen haben, die Rationalisierung auch nicht mehr der Horror. Mit Gewerkschaftern aus den 70er Jahren konnte man nicht darüber reden, dass Automatisierung irgendetwas Gutes haben könnte. Ich glaube, unsere Bedürfnisse und Wünsche werden uns in tiefe Krisen geraten lassen – Krisen, die wir dafür nutzen werden, herauszufinden, was wir wirklich wollen.
Wenn wir 20, 30 Jahre in die Zukunft blicken, wird es den Begriff der Arbeit, so wie wir ihn heute kennen, überhaupt noch geben?
Den Begriff der Erwerbsarbeit wird es noch so lange geben, wie er an die Existenzsicherung gebunden ist. Doch er wird mit neuen Fragen angereichert werden. Ich will mit meiner Arbeit nicht nur zufrieden werden oder Karriere machen. Das, was man ausschließlich der »Generation Y« zuschreibt, gab es tendenziell schon bei den »Babyboomers«: Sie waren bereits für Entschleunigung. Auch Personen aus der »X-Generation«, also denen, die zwischen 1964 und 1979 geboren wurden, würden – erhoben in einem Gedankenexperiment – für sinnvollere Aufgaben auf Status oder Geld verzichten. Viele wollen keinen vertikalen Aufstieg, sondern horizontale Entwicklung und Identitätsbildung. Unter Umständen will man auch mal die Rolle des Projektleiters übernehmen, aber anschließend auch wieder zum Projektmitarbeiter werden. Dieses Verhalten ist intrinsisch motiviert und erzeugt zum Beispiel auch das typische Verlangen, wieder einmal etwas handwerklich machen zu wollen. Gerade in kreativen Berufen gibt es Zeiten, da ist man heilfroh, dass man Wäsche waschen und aufhängen oder putzen und aufräumen kann. Das Bedürfnis, sich auf verschiedene Art und Weise zu beschäftigen, wird zunehmen; mal schweißtreibend, mal relaxend und dann wieder schöpferisch, mal in Einzelarbeit, dann wieder im Team, im Home Office, in der Großgruppe oder an einem angemietet Arbeitsplatz und selbstverständlich auch in der Bahn, vom Urlaub kommend oder in die Ferien reisend. Wenn die Existenzsicherung nicht im Fokus steht – also das Einkommen über das Auskommen hinausreicht –, fangen wir an, uns zu fragen, was wir eigentlich wirklich wollen, und das wird in 30 Jahren anders beantwortet werden als heute. Die Leute wollen heute schon nicht mehr einfach nur zufrieden werden am Arbeitsplatz, für viele wird die Sinnfrage immer wichtiger. Sinn meint dabei nicht, dass die Arbeit »nur« nützlich sein soll für andere oder für die Gesellschaft. Viel wichtiger wird die Frage: Korrespondiert die Arbeit mit meinen Werten; hat das Ganze Sinn für mich? Auch wenn eine Tätigkeit früher Sinn ergeben hat, bedeutet es nicht, dass es sie es auch weiterhin tut. Bestes Beispiel dafür sind Aussteiger. Jemand, der leidenschaftlicher Arzt war, kann plötzlich etwas komplett anderes machen. Diese Position kann ich erst erreichen, wenn ich Freiheit von der Existenzsicherung gewonnen habe. »Wie kann ich werden, was ich bin?«, so fragte Nietzsche. Natürlich nur indem ich tue, komme ich zu dem, was ich eigentlich bin. Wir aber sind dabei, uns durch depressive Stimmung zu entfernen von dem, was wir sind.
Ausgabe Nr. 7, Herbst 2015