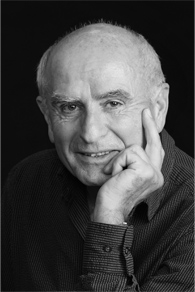Quintilian hatte das nicht anders gesehen und die Frage nach dem Nachahmungswürdigen aus Goethischem Geist (wenn Sie mir diesen Anachronismus erlauben) entschieden. Wächst doch der Mensch mit seinen höhern Zwecken, so dass nur die Besten es sein dürfen, denen er nacheifert. Mit dieser Überlegung war die Idee des Kanon geboren, jedenfalls seinem differenzierten Begriffe nach und wie er die Bildungsgeschichte Europas dominieren sollte. Vorformen gab es natürlich längst, eine creatio es nihilo, ein Entstehen aus dem Nichts heraus, mochte in philosophischer Spekulation noch durchgehen, dem aufgeklärten Geist rhetorischer Rationalität hätte das krass widersprochen.
Ich will gleich eingestehen, dass mir die vielerorts modische und verächtliche Suspendierung des Bildungskanons nicht gefällt. Sie ist nicht nur geschichtsvergessen, sondern oberflächlich und ressentimentbehaftet. Denn was für die Imitatio gilt, gilt auch für ihn: Es kommt auf den Gebrauch an. Man kann ihn als starres, museales Gebilde und Erbauungstempel oder als Laboratorium des Möglichen und Übungsfeld praktischer rednerischer, auch literarischer Tätigkeit nutzen. Er ist zudem Ausweis einer Sprachkultur, der sich die antiken Redner und Philosophen gleichermaßen widmeten – in dem Bewußtsein, dass dem Menschen als zoon logon echon, als sprachlich begabtes Wesen, nichts wesentlicher ist als eben diese seine Sprache. Wobei sie ein so kompliziertes, in alle Lebensbereiche verästeltes System bildet, wie es kein Vergleichbares gibt, in dem also »nicht einfach jeder herumfummeln darf, der (nicht mal) die Gebrauchsanweisung kennt.«
Die Entstehungsgeschichte mag uns über das umstrittene Normenprogramm etwas genauer in Kenntnis setzen. Als Kanon bezeichneten die Griechen zunächst nur Maßrute oder Waagbalken, ein Norm-Maß also, das im Tempel niedergelegt als Richtschnur für das handwerkliche Instrument diente und bei Konflikten zu Rate gezogen wurde. Doch bald schon wurde der Begriff übertragen auf Norm und Regel im allgemeinen und bedeutete schließlich auch einen Traditionsbestand, der das Gültige aus dem Vergänglichen heraushob und der Zukunft zum strebenden Bemühen übermittelte. »Der Kanon«, so fasste zuletzt noch der wohl größte Kenner der europäischen Bildungsgeschichte, Manfred Fuhrmann, seine wichtigsten Funktionen zusammen, der Kanon »sucht zwischen der unüberschaubaren Vielfalt der Kultur und den einzelnen, die an ihr teilhaben, zu vermitteln: er reduziert die Potenzialität auf Aktualität, auf eine, für das einzelne Subjekt überschaubare Auswahl«.
Kein Wunder, dass die Rhetorik, die sich der sprachlichen und rednerischen Ausbildung des Menschen von seinem 1. Lebensjahr an widmet (Quintilian fordert, daß die Amme ein gutes Latein sprechen müsse), daß die Rhetorik auch den literarischen Kanon erfunden hat. Nach der griechischen Bestsellerliste der 10 attischen Redner, unter ihnen Isokrates und Demosthenes natürlich (auch eine Liste der 9 vorbildlichen Lyriker gab es), kurz, nach diesen Vorläufern war es zunächst Cicero, der in einem kurzen historischen Überblick die musterhaften Rhetoren würdigte. Erst Quintilian aber hat diese Liste in dem berühmten und lange Zeit einzig bekannt gebliebenen 10. Buch seiner »Institutio oratoria«, »Über die Ausbildung des Redners«, zu einer Literaturgeschichte avant la lettre erweitert.
Nicht zum Selbstzweck müßiger Lektüre, versteht sich. Urteilskraft und sprachliches Überzeugungsvermögen »erreichen wir aber dadurch«, begründete er seine Absicht, »daß wir das beste lesen und anhören«, um es alsdann nachahmen zu können. Denn, so die ironische Pointe, »beim Hercules, ganz zwangsläufig sind wir den Guten entweder ähnlich oder unähnlich. Ähnlichkeit aber liefert selten die Natur, häufig jedoch die Nachahmung.« Sie erstreckt sich auch hier auf die Sache selber, ihre Perspektivierung, argumentative Bearbeitung und Strukturierung, schließlich auf die sprachliche Formulierung. In diesen Kontext fällt übrigens ein Gleichnis, das uns an unvermuteter Stelle wiederbegegnet: »Wie wir die Speisen zerkaut und fast flüssig herunterschlucken, damit sie leichter verdaut werden, so soll unsere Lektüre nicht roh, sondern durch vieles Wiederholen mürbe und gleichsam zerkleinert unserem Gedächtnis und Vorrat an Mustern (zur Nachahmung) einverleibt werden.« Das ist eine andere Lektürepraxis als die unsere und setzt auf Intensität, nicht Extensität, und blieb bis ins 18., 19. Jahrhundert erhalten. Der große romantische Kritiker Friedrich Schlegel wird das Bild aufgreifen und kritisches Lesen als eine Art »Wiederkäuen« beschreiben.
Doch noch einmal zurück zum Kanonkonzept Quintilians. Diese Bestenliste, der in späteren Zeiten, wie gegen Ende des 18. Jahrhunderts durch die hypertrophe Geniebewegung der Wert abgesprochen wurde (den allerdings die Klinger, Lenz oder Goethe sich vorher durchaus einverleibt hatten), und der heute durch die trivialen Exempel der Alltagsrede weitgehend ersetzt ist – dieser Kanon war als offenes System angelegt und wurde den Erfordernissen rhetorischer Theorie und Praxis gemäß, verändert und weitergeschrieben. Welche Macht ihm zugetraut wurde, hat niemand kürzer und prägnanter in eine Sentenz gebracht als Johann Joachim Winckelmann: »Der einzige Weg für uns, groß, ja, wenn es möglich ist, unnachahmlich zu werden, ist die Nachahmung der Alten.«
Doch das ist nicht alles. Der Kanon verzeichnete zwar in erster Linie Werke der Beredsamkeit, Literatur und Philosophie, aber bereits Platon ernennt in seiner »Politeia« Arithmetik, Geometrie, Astronomie und Musik zu Bildungsfächern, die den Geist für die Anamnesis, für die wahre Erkenntnis frei machen. Im Quadrivium der septem artes liberales, der sieben freien Künste, fanden sie ihren kanonischen Platz und steuerten ihren Teil zum Haushalt der Meinungs- und Bildungsnormen der Gesellschaft bei.
In seiner Gesamtheit transportierte der Kanon, so können wir zusammenfassen, die überzeugungskräftigen sowohl allgemeinen wie konkreten Gesichtspunkte, die griechisch »topoi«, lateinisch »loci« genannt wurden. Sie sind die »Parameter für das Sprach- und Denkverhalten« (Bornscheuer) der meinungsbildenden kulturellen und politischen Schichten. Um ihre Bedeutung für unser Thema und ihre beherrschende Rolle in der Geschichte, im Prozess der Kultur und Zivilisation begreiflich zu machen, muß ich noch einmal etwas ausholen.