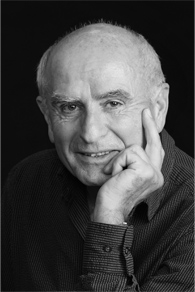Es war ein epochaler Fortschritt schon des antiken Denkens, die Grenzen evidenter, wahrer Erkenntnis ausgemessen zu haben und zu wissen, dass weder Philosophie noch Wissenschaft, als wie exakt sie sich selber auch definieren mochte, ewige Wahrheiten oder endgültige Gewissheiten verschaffen können. Rhetoren wie Protagoras oder Gorgias, aber auch Heraklit haben sich damit nicht zufrieden gegeben; zu dringend verlangten Entscheidungs- und Handlungszwang, worunter menschliches Leben unaufschiebbar täglich steht, einen Ausweg aus dem Dilemma, nicht wahrhaft wissen zu können, was richtig und was falsch ist. Welche Lösungen genau in dieser Frühzeit erprobt wurden, kann man angesichts der dürftigen Quellenlage und der durch die platonische Metaphysik zugedeckten skeptischen Gedankenwelt nur mehr erraten als rekonstruieren. Jedenfalls (ich kürze hier sehr ab) führten die entsprechenden Überlegungen über Platon hinaus zu den erkenntniskritischen Schriften seines Schülers Aristoteles, für uns hier einschlägig seine »Rhetorik« und seine »Topik«.
Seine Aufgabe hat er klar ausgesprochen, nämlich »eine Methode zu finden, nach der wir über jedes aufgestellte Problem aus wahrscheinlichen Sätzen (denn wahre Sätze besitzen wir in aller Regel nicht) Schlüsse bilden können und, wenn wir selbst Rede stehen sollen, in keine Widersprüche geraten«. Diese »wahrscheinlichen Sätze«, die allgemein gelten, weil sie auf dem »consensus« aller oder jedenfalls der meisten beruhen, heißen »endoxa«; in ihnen sind auch die »topoi«, die Bausteine des rhetorischen Schlussverfahrens verankert, damit ihre Glaubwürdigkeit. Das sind zum Beispiel die topoi über »Potenzialität und ihr Gegenteil, ob etwas geschehen sei oder nicht, ob es sein wird oder nicht, sowie über Größe und Kleinheit von Dingen«.
Was er damit meint, hat Aristoteles breit ausgeführt und an Beispielen illustriert. »Ferner gilt überhaupt das Schwerere mehr als das Leichtere, denn es ist seltener. Andererseits gilt das Leichtere mehr als das Schwerere, es verhält sich nämlich so, wie wir es wünschen.« Jeder topos, heißt das, kann Prämisse verschiedener, sogar entgegengesetzter Schlüsse sein, je nach dem Beweiszusammenhang, den er im Kontext aktualisieren soll. Dieses topische Verfahren ist zuständig, wenn das in Frage stehende Problem nicht durch Messen, Wägen oder mathematische Operation zu lösen ist, also in allen Fragen, über die man, wie die Redensart lautet, geteilter Meinung sein kann.
Mit diesen knappen Hinweisen mag es genügen, denn Sie werden sich mit Recht fragen, was denn dies alles mit unserem Thema zu tun hat! Nun, auch die Topik ist ein bedeutender Gegenstand der »imitatio« durch die Jahrhunderte geblieben. Für uns wichtig sind dabei zwei Punkte. Diese topoi genannten Allgemeinüberzeugungen sind von unterschiedlicher Konkretheit. Der Topos aus dem »Mehr oder Weniger« – zum Beispiel im Argument: »wenn es dafür kein Gesetz gibt, wie soll ich dann wissen, in diesem besonderen Fall falsch gehandelt zu haben?« – dieser Topos ist abstrakt und universal verwendbar, spielt auch in der Alltagsrede eine große Rolle. In den konkreten Topoi haben sich die allgemeinen Gesichtspunkte zu Merksätzen verfestigt, die oft zu Sprichwörtern wurden. Für unseren Zusammenhang etwa zum Sprichwort »wer einmal lügt, dem glaubt man nicht«. Je konkreter der Topos, umso geringer seine Einsatzmöglichkeiten, was aber die langanhaltende Wirkung nicht beeinträchtigen muß. Ernst Robert Curtius hat mit ihnen das Modell einer literarischen Topik gewonnen und gezeigt, wie etwa die Bestandteile des locus amoenus, des lieblich schönen Landschafts-Ensembles oder die Gestalt des deus artifex im Prozeß der schöpferischen Nachahmung durch die Geschichte wandern.
Für die Rhetorik entscheidet sich die Bedeutung eines Topos im Redegebrauch, da muß er sich bewähren. Solange seine Norm unangefochten ist – in der westlichen Welt gilt das etwa für den Katalog der Menschenrechte –, genügt die einleuchtende Referenz. Umgearbeitet oder suspendiert muß er werden, wenn seine Geltung stark eingeschränkt ist. Jedesmal aber verlangt die Adaption an den konkreten Fall »argumentative Phantasie«. Um es am literarischen Beispiel zu erläutern, das ich eben zitierte: Der locus amoenus in einer antiken Hirtendichtung ist ein anderer als der locus amoenus in Coopers »Waldläufer«, obwohl auch darin alle bekannten Bestandteile wiederkehren. Nicht anders in einer Debatte über die Gleichbehandlung von Mann und Frau im Arbeitsprozess: Inwiefern darin Normen eines Menschenrechts eine Rolle spielen, ist von jedem Redner zunächst plausibel zu machen, bevor die Argumentation einleuchten kann. Immer kommt es darauf an, die in der Topik überlieferten, im Kanon der »auctores« aufgenommenen, oft in sinnliche Anschauung übersetzten Allgemeinüberzeugungen auf den neuen Kontext hin durchzuführen, wie ein Thema in der Musik »durchgeführt« wird. Dazu noch einmal Quintilian: »Denn wer sich bemüht, vorne zu sein, dem wird es vielleicht gelingen, auf gleicher Höhe zu sein, wenn auch nicht (immer) zu überholen. Niemand aber vermag, mit dem auf gleicher Höhe zu sein, in dessen Spuren er stets glaubt treten zu müssen; denn wer folgt, muß immer zurückbleiben.«
Kein Zweifel, wenn wir von den Praxiserfordernissen aus auf den Kanon blicken, auf diesen Schatzbehalter plausibler Prämissen, exemplarischer Fälle und Stoffe, so kann man von steriler Erstarrung nur in den Fällen sprechen, in denen er sich vom Gebrauch gelöst hat und unwirksam geworden ist. Im übrigen aber ergänzen sich die Dekanonisierung abgegoltener und die Kanonisierung neuer Autoren im lebendigen Wechselspiel. Seine Weiterentwicklung, die jeder neue Praxisfall schließlich im Interesse der Glaubwürdigkeit verlangt, fußt auf einer Verständigung, die über die Grenzen von Parteien und Bekenntnissen hinausgeht. Walter Jens hat einmal diese gemeinschaftsstiftende Kraft des Kanon gerade an einem besonders heiklen Beispiel bekräftigt: »Ein scheinbar befremdlicher, in Wahrheit plausibler Gedanke: das Pantheon des 19. Jahrhunderts, bevölkert von Männern, zwischen denen es im Raum der Politik keine Gemeinsamkeit gab, (…) deren Lehren sich diametral unterschieden, und alle hatten genau die gleiche Bildung genossen, alle die gleichen Texte gelesen: das gab ihnen die Möglichkeit, sich einander noch in schroffster Gegnerschaft auf gemeinsamer Basis verständlich zu machen.«