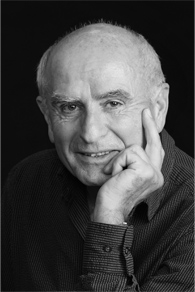Bleibt zu fragen, was denn diese »Natur« ist, die in der Genieästhetik an die Stelle klassischer Muster rücken sollte? Ihre Vorstellung nährt sich aus Elementen antiker Spekulation von einer subjekthaften Natur, auch einer natura naturans, deren Wesen Kraft und Energie ist. Ideen, die durch die Epochen geistern, und mit mythologischen Zutaten versetzt sind, wie uns Goethes »Faust« so schön belehrt. Übrigens ist die Antike selbst in dieser Generation nie ganz abgeschrieben: Prometheus ist ihr erster Heiliger im neuen Kalender. Diese Natur ist aber ebenso eine Konstruktion aus dem Kopf heraus wie ihr mechanistisches Pendant, das ihr bald folgen wird. Das Genie selber tritt uns, genau gemustert, als eine Kunstfigur entgegen. Deren vollkommene Verwirklichung kann man am Schweizer Autor Christoph Kaufmann studieren, einem vorzeitigen Popartisten, der eine Art Regelwerk für Genies geschrieben hat, von Hof zu Hof zog, eine bunte Show abzog, sich ungebärdig, unverschämt und skandalös, eben Geniezeit-gemäß benahm, und derart seinen Unterhalt verdiente.
Im 19. Jahrhundert waren solche Auswüchse bald vergessen, auch der kürzlich noch wüst beschimpfte Kanon kam zu neuen Ehren. Friedrich Schlegel entdeckt erneut die mustergebende Poesie der Griechen, Hölderlin macht aus seiner Bewunderung für sie gleichfalls kein Hehl und sogar ein revolutionärer Autor wie Karl Marx erklärt die »griechische Kunst und Epos«, obwohl an längst überwundene ökonomische Entwicklungsformen geknüpft, dennoch »in gewisser Beziehung als Norm und unerreichbare Muster« – und das in einem Buch, das sich die Kritik der politischen Ökonomie zum Ziel gesetzt hat.
Dennoch dürfen wir nicht in den Fehler verfallen zu glauben, alles sei nun wieder beim Alten, Gewohnten. Das Imitatio-Konzept in der Rhetorik, sehr viel mehr aber in der Literatur, ändert sich, dabei fallen, soweit ich sehe, zwei Haupttendenzen auf, die beides Verlustreaktionen sind. Hölderlins vielzitierter Zweifelsruf »Warum Dichter in dürftiger Zeit?« reagiert auf den Verlust an Sicherheit, die der Dichter in einer Ständegesellschaft fraglos seinen Besitz nennen konnte. Er hat ihn ausgetauscht gegen Unabhängigkeit, aber auch gegen stetige ökonomische und soziale Gefährdung. Man benötigt ihn nicht mehr zur Lebensmeisterung, dafür haben sich längst andere Instanzen eingerichtet. Ob Wilhelm Meister heute noch zum Theater ginge? Wohl eher zum Therapeuten, wenn er überhaupt so komische Vorstellungen entwickelte, wie sein Vorgänger.
Und der Autor? Braucht er noch einen Kanon in dieser seiner so arg beschränkten Arbeitswelt? Nicht mehr im Sinne einer systematischen, in sich verschränkten, zusammenstimmenden Bezugsgröße, sondern als beliebig verfügbares Reservoir von Spielformen, die von ihren religiösen oder ideologischen Bindungen gelöst und mit neuem Sinn aufzuladen sind. Ein Sinn aber, der auf Allgemeinheit und objektive Geltung von vornherein verzichtet. Stattdessen wird sich der Autor in diesen entleerten Formen selber zum Gegenstand, wandert als Odysseus durch die moderne Stadt oder verliert sich verzweifelt im Schloss der Welt.
Die zweite Tendenz möchte ich an einem spektakulären Ereignis aus den Anfangsjahren der Entwicklung illustrieren, die ich jetzt verfolge. Am 10. November 1793 feiert das revolutionäre Frankreich (und mit ihm seine Sympathisanten in ganz Europa) das Fest der Vernunft. Eigentlich bedeutsam ist der Ort dieser Feier, nämlich eine Kirche, oder besser die Kirche in Paris, nämlich Notre Dame. Was ist daran für uns wichtig? Weniger die Kostümierung, das antike Gepräge des Ablaufs, als die eben besprochene Sinnentleerung, deren Funktion hier anderer Art ist. In Gestalt ästhetische Repräsentation holt sich die Gesellschaft zurück, was sie vorher zu diesem Zweck entfernt hat.
Doppelausgabe Nr. 8 und 9, Herbst 2016