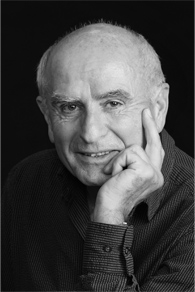Mit Aristoteles betreten wir wieder auch rhetorischen Boden – der war allerdings gut vorbereitet. Er konnte auf Gedankenentwicklungen zurückgreifen, die sich außer bei Protagoras (den ich hinreichend gewürdigt habe) auch bei anderen, etwa Gorgias und Antiphon finden, welch letzterer in Korinth eine Art Praxis unterhielt, in der er die an Sorgen und Ängsten Leidenden durch tröstende Rede zu heilen versprach. Gorgias’ Perspektive ist gar nicht so fern davon, in ihr mag der Einfluss eines Bruders, der Arzt war, ihre Spuren hinterlassen haben. Zu ihrer Erhellung wähle ich eine Stelle aus der berühmten Rede zur Verteidigung der Helena, die er wohl vor 415 v. Chr. gehalten und die mit dazu beigetragen hat, ihn zum Begründer der epideiktischen Beredsamkeit zu machen. »Im selben Verhältnis«, so dekretiert er, »steht die Wirkkraft der Rede zur Ordnung der Seele wie das Arrangement von Drogen zur körperlichen Konstitution: Denn wie andere Drogen andere Säfte aus dem Körper austreiben, und die einen Krankheit, die anderen aber das Leben beenden, so auch erregen unter den Reden die einen Leid, die andern Genuß, und dritte Furcht, und wieder andere versetzen die Hörer in zuversichtliche Stimmung, und noch andere berauschen und bezaubern die Seele mit einer üblen Bekehrung. Daß sie (Helena) mithin, wenn sie durch Reden bekehrt wurde, kein Unrecht tat, sondern ins Unglück geriet, ist so ausgesprochen.«
Das ist natürlich eine zweideutige Instrumentalisierung, die vom Raub der Affekte spricht, um von Verantwortung loszusprechen, und wird später Platon gerade recht kommen. Für uns ist der Vergleich lehrreich und durchaus nicht diskriminierend. Er verweist auf den Zusammenhang von medizinischer und rhetorischer Affektenlehre, der sich nie ganz gelöst hat und heute etwa in der Kooperation mit emotions-psychologischen Konzepten eine Art von Fortsetzung findet. Hippokrates ist von medizinischer Seite ihr bedeutendster Ahnvater. Auch im Zentrum seines Interesses stand der Zusammenhang von rationalen und affektischen Vermögen, unterschied er doch eine gesunde, die Erkenntnis des Schönen und Hässlichen, Guten und Bösen, Angenehmen und Unangenehmen fördernde und eine krankhafte, erkenntnishemmende Betätigung der Affekte. Beides erklärt er als Folge eines bestimmten Feuchtigkeits- und Wärmegrads des Gehirns, der sich durch medizinische Mittel beeinflussen läßt.
Es liegt auf der Hand, dass für die Rhetorik derartige Zugriffe von praktischer Bedeutung sind, und sie machte sich daher auch die therapeutische Kraft der Affektbeeinflussung zunutze, indem sie der affekterregenden Rede nun die gleiche Wirksamkeit zuschrieb, wie die Heilmittel sie für den Körper entfalten. Dabei braucht uns die überholte Begründung in der Säftelehre nicht zu irritieren, das bis heute gültige Ergebnis der Erfahrung ist entscheidend, dass emotionale Gestimmtheit und Erkenntnis – modern formuliert: Erkenntnis und Interesse – in einer offenbar anthropologisch fundierten engen Beziehung stehen. Lykurgos, ein Redner des 4. Jahrhunderts v. Chr. In Athen, rät in der einzigen erhaltenen seiner 15 Gerichtsreden, die natürliche Gefühlslage der Richter zu »éleos«, also zur Rührung, zum Mitleid vielleicht sogar, zu steigern, um sie besser zu überzeugen. Aristoteles wird diesem Wechselverhältnis dann seine besondere Aufmerksamkeit zuwenden. Den Anstoß gibt auch für ihn die Erfahrung, dass die emotionale Verfassung der Adressaten für die Überzeugungskraft der Rede keineswegs gleichgültig ist. Gleich zu Anfang des 2. Buches seiner auf Vorlesungen basierenden »Rhetorik«, in der er seine rhetorische Affektenlehre formuliert, umreißt er eindringlich das Kernproblem, ich zitiere die Stelle daher ungekürzt: »Denn im Hinblick auf die Glaubwürdigkeit macht es viel aus – besonders bei den Beratungen und schließlich vor Gericht –, dass der Redner in einer bestimmten Verfassung erscheine und dass die Zuhörer annehmen, er selbst sei in einer bestimmten Weise gegen sie disponiert, und schließlich, ob auch diese sich in einer bestimmten Disposition befinden. Daß der Redner nämlich in einer bestimmten Verfassung erscheine, ist besonders nützlich bei der Beratung, und dass der Hörer in einer bestimmten Weise disponiert sei, ist vorteilhafter bei Gerichtsverhandlungen; denn ein und dasselbe erscheint nicht in gleicher Weise den Liebenden und Hassenden bzw. den Zornigen und denen in sanfter Gemütslage, sondern die Ansichten sind entweder ganz und gar oder hinsichtlich ihrer Gewichtigkeit verschieden: dem Liebenden nämlich erscheint der, über den er ein Urteil zu fällen hat, entweder gar nicht schuldhaft oder nur in geringem Maße, dem Hassenden dagegen umgekehrt. Ebenso erscheint demjenigen, der von Verlangen und Hoffnung erfüllt ist, das, was kommen soll, sofern es angenehm ist, als etwas, das wirklich kommt, und als etwas Gutes; bei dem aber, der gleichgültig und in verdrießlicher Stimmung ist, ist das Gegenteil der Fall.«
Damit wir diese Schlussfolgerungen in ihrer Bedeutung auch einsehen, müssen wir uns daran erinnern, dass die Rhetorik es immer mit konkurrierenden Standpunkten zu tun hat, mit grundsätzlich gleichberechtigten Meinungen, und dass in diese bereits Gefühlsgründe eingegangen sind, noch bevor eine strittige Deutung des Sachverhalts wirklich auf der Tagesordnung steht. Vernachlässigt man diese bereits vorhandenen affektiven Stellungnahmen, ist die Persuasion von Anfang an gefährdet. Das sind ganz redepraktische, der menschlichen Natur aber entsprechende Überlegungen, die Aristoteles auch in der »Nikomachischen Ethik« anstellt: »Rede und Belehrung«, heißt es dort über die Erziehung zur Tugend, »werden wohl nicht bei allen Menschen (wunschgemäß) wirken, sondern zuvor muß die Seele durch Gewöhnung bearbeitet werden, daß sie sich in rechter Weise freut und hasst, so wie man die Erde bearbeitet, die den Samen pflegen soll.« Im übrigen tadelt der Autor der »Ethik« sowohl Übermaß wie Mangel an affektischer Stimulierung, heißt sie aber gut, wenn man weiß, »was man soll und wobei man es soll und wem gegenüber und wozu und wie, das ist die Mitte und das Beste …« Wie nebenbei erscheint bei dieser Austarierung des rechten, nämlich mittleren Affektmaßes ein kleiner Katalog von Topoi in Frageform und weist hinüber zur rhetorischen Beglaubigung.
Im Kontext dieser Erörterungen bleibt die Stellung der Affekte zum Logos allerdings nicht eindeutig. Einmal scheint es so, als ob Aristoteles den rein argumentativen Begründungsverfahren die Priorität zuerkennt, mit anderen Worten: im Enthymem, dem rhetorisch-rationalen Schlussverfahren, die »Grundlage der Überzeugung« sieht und affektische Mittel für fragwürdig und nur dem ungebildeten Publikum geschuldet erklärt; andererseits wiederum, wir hörten die Sätze, den affektischen Dispositionen eine entscheidende Rolle bei der Überzeugung einräumt.