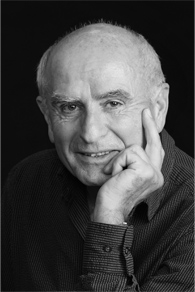Da haben wir die vertraute Trias, die in Ciceros Text als »probare«, delectare (auch »conciliare«) und »movere« (oder »permovere«) auftaucht. Anders als auch ich selber früher meinte, kommt aber der Unterschied zu Aristoteles in anderen Kontexten stärker heraus als es zunächst den Anschein hat. Die Person des Redners tritt für Cicero in ungleich stärkerem Maße als ausgezeichnete Instanz in den drei, die Rede definierenden Hinsichten Redner, Redegegenstand und Hörer hervor. Unmißverständlich verkündet Crassus, dem der Autor meist die eigenen Ansichten überantwortet: »In meinen Augen gibt es ja auch nichts Herrlicheres, als wenn man es vermag, die Menschen durch die Rede in seinen Bann zu schlagen, ihre Neigung zu gewinnen, sie zu verleiten, wozu man will, und abzubringen, wovon man will.« Da sind wir beinah bei dem Gegensatz zum aristotelischen Rhetor. Im »Orator« wird Cicero noch deutlicher, wenn er nach dem schlichten und dem anmutigen Redner dem dritten Typus die Krone der Beredsamkeit zuspricht. »Der Redner der dritten Gattung ist jener erhabene, reiche, eindringliche, schmuckvolle, welcher in der Tat die höchste Kraft besitzt. Das ist der Redner, dessen Schönheit und Fülle die Völker anstaunt, in dessen Bewunderung sie der Beredsamkeit den größten Einfluß in den Staaten einräumten … Diese Beredsamkeit versteht es, sich der Zuhörer zu bemächtigen … : sie bricht sich bald mit Gewalt Bahn, bald schleicht sie sich unbemerkt in das Herz, pflanzt neue Ansichten ein, reißt eingewurzelte aus.«
Das klingt in unseren Ohren fast wie eine Propaganda- und Werberhetorik avant la lettre oder zumindest nach einer Lobrede auf den Demagogen. Cicero derart wie Theodor Mommsen zu denunzieren liegt mir aber fern und würde ihm nicht gerecht, zumal er der damit einhergehenden Gefahr auf eigene Weise entgegnen sollte. Wir müssen uns bewusst sein, dass der Autor der in Europa einflußreichsten Rhetorik in der römischen Adelsrepublik andere Bedingungen vorfand und auf anderen historischen Erfahrungen aufbaute, als sein griechisches Vorbild in den Stadtstaaten. Hegel hat den »Räuberanfang« des römischen Staates, seine auf Überwältigung der Nachbarn, auf Gewalt und Krieg beruhende Stiftung dafür verantwortlich gemacht, dass »nicht ein sittlicher, liberaler Zusammenhang (wie in Athen), sondern ein gezwungener Zustand der Subordination« den sozialen Zusammenhalt der Menschen zu garantieren hatte – weitab von Díke und Aidós. So kommt es auch, dass das Ethos des Redners weitgehend mit seiner Autorität zusammenfällt, die auch in Rom anders zustande kam als in Athen. Das Autoritätsprinzip, die »auctoritas«, so wird man sagen dürfen, ist im römischen Verständnis keine Eigenschaft, die jeder so ohne weiteres erwerben konnte, sie verdankt sich, wie Machtmittel oder Adel, den Umständen und dem Zufall, ihre Geltung geht bis in die ältesten Zeiten römischer Geschichte zurück. Sie teilt die Gesellschaft in jene, die über Autorität und Macht verfügen, und diese, die sie anerkennen, sich unterordnen. Die Person (oder Institution wie später der Senat), der auctoritas zugebilligt oder zugeschrieben wird, ist maßgebend für familiäre, für berufliche, für politische Fragen. Der eigentliche Grund solcher Autorität lag aber nicht in der Verfügung über die Sache, sondern diese erhielt Verbindlichkeit erst aus der durch keinen Vernunftgrund, keine überragende Leistung legitimierten auctoritas. Zuletzt basieren solche Ansichten gewiss noch auf ursprünglicher Unterwerfung, doch transformieren sie sie in ein von Freiwilligkeit geprägtes Vertrauen, das Cicero nun wiederum zur Naturanlage machen möchte: »Wenn aber ein freies Volk wählt, wem es sich anvertraut, und, wenn es nur bewahrt bleiben will, gerade die Besten wählt, ist sicher das Heil des Staats in der Einsicht der Besten gegründet, zumal die Natur es so eingerichtet hat, dass nicht nur die an Tüchtigkeit und Energie Höchsten die Schwächeren führen, sondern dass diese auch den Höchsten gehorchen wollen.«
Man kann es nicht deutlicher sagen. Der ideologische Grund von Ciceros Auffassung ist das Ständeprinzip der Adelsgesellschaft, in dem rhetorisch nur reüssiert, der zu den Spitzen der Gesellschaft gehört oder – und das ist nun der Beweggrund für die Auszeichnung der Macht der Affekte – der als »homo novus« wie Cicero die altüberlieferten Standesschranken durchbrechen will und dazu die Gewalt der Leidenschaften mobilisiert.
Die Gefahren im Gefolge solcher Feldzüge hat Cicero nicht übersehen, er wurde schließlich, wie man weiß, ebenso ihr Opfer wie die Republik, die er so unerschrocken verteidigte. Fehlt nämlich dem Redner moralische Integrität und humane Bildung, wird die Rhetorik, wie er mit deutlichem Wort warnte, »zur Waffe in der Hand eines Rasenden«.