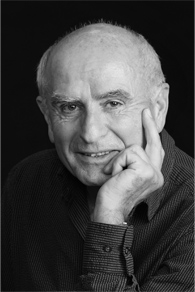Das ist natürlich nicht falsch, aber doch der Anlaß für eine weitere kritische Fußnote, die ich mir nicht entgehen lassen möchte, und die am Begriff des Schemas ansetzt. Auch wenn damit eine sozusagen didaktische Vereinfachung, ein Herausarbeiten von typischen Merkmalen gemeint ist, so trennt das Schema (eben auf schematische Weise), was nach rhetorischer Überzeugung spätestens, wie uns erinnerlich, seit Protagoras als zusammengehörig gedacht und auf komplexe Weise vermittelt ist. Erst die Synthesis, in der das Trennende von affektiven und rationalen Kräften aufgehoben ist, könnte dann im Lichte dieser Allianz mit Fug und Recht zum »bewegenden Prinzip« der Rhetorik erhoben werden.
Dann verwundert es auch nicht, dass Irrationalität kein Problem des rhetorischen Zugriffs auf die Affekte benennt. Zwar wurzeln die vitalen Äußerungen des Menschen in seiner Natur, sie sind aber, als menschliche, damit auch unnatürlich, denn wir kennen die Natur selbst nur als geschichtliche, und es sind historische Konstellationen, die wir hier verfolgen. Für die Rhetorik sind die Affekte kein natürlicher Rohstoff, sie treten ihr immer schon als bearbeitete, verfremdete, gegebenenfalls kultivierte entgegen, zu deren weiterer Verfeinerung sie ihre Institutionen schuf. Das hat niemand klarer gesehen als Friedrich Nietzsche, der letzte meiner Gewährsmänner für heute, der die Affekte mit einem stets bereiten rhetorischen Wissen im Hintergrund erforschte. Indem er auf der einen Seite die untauglichen Methoden der Verbannung und Verleugnung, der Verteufelung und Ausrottung der Leidenschaften kritisierte und die Motive dahinter bloßlegte, erkannte er andererseits, welche Kraftquellen in ihnen stecken, und dass es nicht um ihre Negation, sondern um Sublimierung und Beherrschung geht. Zumal man sich keinen Illusionen hingeben darf, was die Allgegenwart der Affekte betrifft: »(…) und überhaupt herrschen schon bei den ›einfachsten‹ Vorgängen der Sinnlichkeit die Affekte, wie Furcht, Liebe, Haß, eingeschlossen die passiven Affekte der Faulheit.«
»Überwindung der Affekte?«, fragt er ironisch, » – Nein, wenn es Schwächung und Vernichtung derselben bedeuten soll. Sondern in Dienst nehmen …« So lesen wir in einer späten Notiz von 1885. Das klingt gewalttätig und nach Unterdrückung, und tatsächlich spricht Nietzsche im selben Zusammenhang auch davon, sie, die Affekte, »lange zu tyrannisieren«, könne dazu gehören. Dennoch ist bare Unterdrückung nicht gemeint, sondern temporäres Einschränken. In der »Morgenröte« finden wir das entsprechende Gleichnis: »Man kann wie ein Gärtner mit seinen Trieben schalten … und die Keime des Zornes, des Mitleidens, des Nachgrübelns, der Eitelkeit so fruchtbar und nutzbringend ziehen, wie ein schönes Obst an Spalieren …«
Das sind nur die wichtigsten Konsequenzen, die Nietzsche aus der Unausweichlichkeit der Gefühle zieht. Affektlose Zustände gibt es nicht, der Logos selber, Wissen und Beweisen bewirken Zutrauen und Vertrauen, wie in ihnen selber Spannung und Zuversicht wirksam sind. Selbst das mathematische Beweisen ist davon nicht ausgenommen und nach einem Wort Einsteins, soll der Beweis nicht nur richtig, also wahr, sondern auch schön sein. Unsere eigene tägliche Erfahrung zielt übrigens in dieselbe Richtung. Das Ansehen und die Vertrauenswürdigkeit des Experten in unseren öffentlichen Debatten erwachsen aus eben derselben Quelle.
Dass sie in diesen Fällen oft auch trübe sprudelt, bringt uns zum rhetorischen Ausgangspunkt zurück. Denn tatsächlich ist der Geltungsanspruch der Gefühle, so sublimiert oder kultiviert sie auch immer auftreten, natürlich mit einem mathematischen Beweis nicht zu vergleichen. Im Nachlass der achtziger Jahre notiert Nietzsche zur Funktion der Affekte, dass sie »eine Auslegung, eine Art zu interpretieren« sind, damit aber in Aufgabe und Wirksamkeit der Meinung entsprechend. Aristoteles hatte sie bereits als eine Art Meinung bezeichnet und damit ihre Vorschlagsfunktion pointiert. Wie eine Meinung vorläufig ist, daher etwa im Vergleich und in der Auseinandersetzung mit abweichenden Meinungen geprüft, bezweifelt oder erhärtet werden muss, eben so gestaltet sich der rhetorisch bewusste Umgang mit Gefühlen, und nur dann initiieren und fördern sie Erkenntnis, anstatt ihr zu schaden. Mit den Worten Nietzsches, der Triebe, Affekte und Gefühle begrifflich ineins setzte: »die Triebe unterhalten als Fundament der Erkenntnis, aber wissen, wo sie Gegner des Erkennens werden«. Zum Gegner des Erkennens und der Überzeugung werden sie nicht von sich aus, sondern durch ihren Gebrauch. Wir begegnen zum ersten Mal einem Menschen, sind sympathisch oder unsympathisch berührt oder vom passiven Affekt der Gleichgültigkeit erfasst – wie immer die Begegnung ausfällt, unsere Gefühle machen uns einen Entwurf; ihn absolut zu setzen, würde ihn mit einer Autorität beschweren, die ihm nicht zusteht, weil er sie nicht haben kann, derjenigen nämlich, unverstellten Zugang zur Wahrheit zu haben.