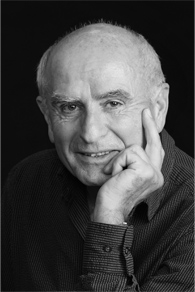Eben solchen aber suggeriert der Begriff des »Irrationalismus«, insbesondere dann, wenn er in die Nachbarschaft der Lebensphilosophie des beginnenden 20. Jahrhunderts gerückt wird, wie Dockhorn es tut, wenn er sich auf Alfred Bäumler beruft, eine Adresse, die ihn hätte misstrauisch machen müssen, handelte es sich bei ihm doch um den neben Rosenberg einflußreichsten Ideologen des »3. Reichs«, der seine irrationalistische Subjektphilosophie bruchlos in den Faschismus integrieren konnte. Dieser Irrationalismus ist der Name für die polemische Absage an Vernunft und Verstand und deshalb mit Rhetorik unvereinbar, weil er die Bereiche des individuellen Erlebens, des individuellen Gemüts, der einzigartigen Gefühlswahrheit als unzugänglich jeder vernünftigen Einrede, jeder überindividuellen Geltung annimmt und damit rhetorischem Überzeugen den Boden entzieht. In seiner Konsequenz läuft das, mit den Worten des von Sympathie dafür nicht freien Karl Mannheim, hinaus auf »eine immer konsequenter werdende Ausmerzung der liberal-rationalen Elemente aus dem nunmehr bewusst als irrational beabsichtigten Weltbilde.« Eine gerade deshalb hellsichtige Diagnose, weil sie politischen Folgen nicht unbeachtet läßt.
Ich sagte, Gefühle sind wie Meinungen Vorschläge, Entwürfe, sie lösen ein Fraghaftes in vorläufigen, noch fragilen Stellungnahmen, deren Überzeugungskraft durch zwei Referenzen begründet wird. Beide weisen weit in die Antike zurück. Die eine hat auch Kant, und zwar in seiner Anthropologie, markiert, indem er darauf aufmerksam machte, dass es immer »die Vorstellung von etwas Künftigem« ist, welches das affektive und leidenschaftliche Begehrensvermögen antreibt. Futura consequentia, die zukünftigen Folgen sind es, auf die die Affekte per se zielen, vom Wünschbaren oder Befürchteten her gewinnen sie ihre Energie und Glaubwürdigkeit, sie stiften den für die Rhetorik bei aller Situativität lebenswichtigen Zukunftsbezug, den augenblicklichen Zeitpunkt, sogar den Kairos tranzzendierend. Er bewegt selbst die Gerichtsrede, die zwar von der Vergangenheit einer Tat und ihrer Umstände ausgeht, dies aber im Interesse eines noch ausstehenden Gerichtsspruchs, Urteils und damit der Folgen für alle Beteiligten. Anders wäre die jeweils nötige »Belebung des Willens« beim Adressaten nicht zu erreichen, die Rede bliebe im empirischen Aufweisen, im Zeigegestus wirkungslos stecken.
Was aber macht die Gefühle der einzelnen Bürger nun auch vergleichbar und damit erst verständlich? Die Antwort überrascht und enttäuscht: Wir wissen es nämlich nicht. Was umso paradoxer wirken mag, als wir ständig handeln und leben, als ob wir es wüssten. Wenn wir uns ängstigen, erwarten wir Mitgefühl (Angst steckt auch an, so sagen wir mit einer Allgemeinerfahrung), wenn wir uns freuen, wollen wir, dass auch andere sich mit uns freuen, auch Freude ist eben ansteckend. Für dieses merkwürdige Phänomen des individuellen Gefühls, das von Erfahrungen ausgeht, die eigentlich nur ich alleine aufzuweisen habe (weshalb ja die Lebensphilosophie das als unergründliches Geheimnis hypostasierte), für dieses offenbar irreduzible Wesen hat Protagoras zur Erklärung einen Mythos und die Rhetorik insgesamt einen »Sinn« erfunden, dessen wir uns selbstverständlich bedienen, dem aber kein Organ zuzuordnen ist, auch wenn wir seine Wirkung kennen. »Ursachenbären« hat Lichtenberg den Menschen genannt, um seinen Eifer, nach Ursprüngen zu suchen, wo Wirkungen genügen, zu karikieren. Blumenberg hat es nicht anders gesehen: »Die Antithese von Wahrheit (also hier: was ist dieser »Sinn« in Wahrheit) und Wirkung ist oberflächlich, denn die rhetorische Wirkung ist nicht die wählbare Alternative zu einer Einsicht, die man auch haben könnte, sondern zu der Evidenz, die man nicht oder noch nicht, jedenfalls hier und jetzt nicht, haben kann.«
Das gilt allgemein und im besonderen für jenen Sinn, der rhetorisch »sensus communis« genannt wird und der für unsere Gefühlsgründe dieselbe Funktion hat, wie die »wahrscheinlichen Sätze«, die es nach Aristoteles braucht, damit wir »über jedes aufgestellte Problem (…) Schlüsse bilden können«, also mit anderen, mit Ciceros Worten, »einen angzweifelten Sachverhalt absichern«. Um die Zuverlässigkeit unserer Gefühlseinstellung zu prüfen und damit ihre allgemeine oder auf ein besonderes Publikum bezogene Wirkung in Rechnung stellen zu können, beziehe ich mich auf Gemeingefühle. Aristoteles hat sie in einer Topik zusammengestellt, ohne Vollständigkeit zu beanspruchen – schließlich sind sie trotz temporärer Allgemeingültigkeit historisch und kulturell variabel, damit offen. Das Schlußwort zu diesem weiten Feld der Gefühlsrede aber mag Nietzsche für mich formulieren: »Nachträglich, in langer Gewöhnung, sind gewisse Vorgänge und Gemeingefühle sich so regelmäßig verbunden, dass der Anblick gewisser Vorgänge jenen Zustand des Gemeingefühls hervorbringt und speziell irgendjene Blutstauung, Samenerzeugung usw. mit sich bringt: also durch die Nachbarschaft. ›Der Affekt wird erregt‹, sagen wir dann.«