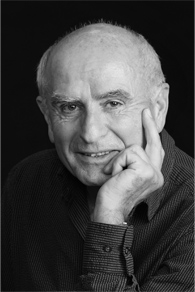Tagung »text | text | text« | Vortrag
»Gebraucht sind die Gedankensachen schon alle«
Über Originalität und Nachahmung
Im Rahmen der Tagung »text | text | text – Zitat, Referenz, Plagiat und andere Formen der Intertextualität« trug Gert Ueding am 11. Juni 2016 das untenstehende Manuskript vor.
Sehr geehrte Damen und Herren,
die passionierten Wilhelm-Busch-Leser unter Ihnen haben die beiden Titel-Verse meines Vortrags längst erkannt. Sie bilden den Schluss eines Gedichtes, das Busch in dem späten schmalen, 1904 erschienen Bändchen »Zu guter letzt« aufgenommen hat – sein Titel: »Erneuerung«. Es berichtet von einer resoluten Mutter, die aus einem alten Kleiderschrank einen abgetragenen »Schwalbenschwanz«, einen Frack also, herausholt: »Ihn trägt sie klug und überlegt / Dahin, wo sie zu schneidern pflegt, / und trennt und wendet, näht und mißt, / Bis daß das Werk vollendet ist. // Auf die Art aus des Vaters Fracke / kriegt Fritzchen eine neue Jacke. // Grad so behilft sich der Poet. / Du liebe Zeit, was soll er machen? / Gebraucht sind die Gedankensachen / Schon alle, seit die Welt besteht.«
Das sind in schönster Busch-Art gereimte »bummlige Verse«, die nicht nur das eigene poetische Verfahren verschmitzt karikieren, sondern weit darüber hinaus reichen, weiter, als der immer noch als deutscher Haushumorist verkannte Dichter und zu seiner Zeit avantgardistische Maler wohl selber beabsichtigt hat. Das älteste uns bekannte Zeugnis solchen Denkens stammt aus Ägypten, und zwar, man kann es sich kaum vorstellen, aus dem 2. Jahrtausend vor Christus. »Oh, daß ich unbekannte Sätze hätte, seltsame Aussprüche, / neue Rede, die noch nicht vorgekommen ist, / frei von Wiederholungen, / keine überlieferten Sprüche, die die Vorfahren gesagt haben./ Ich wringe meinen Leib aus und was in ihm ist / und befreie ihn von allen meinen Worten. / Denn was gesagt wurde, ist Wiederholung / und gesagt wird nur, was (schon) gesagt wurde.«
Der anonyme Autor dieser Zeilen hat ersichtlich den Weg noch nicht entdeckt, den Wilhelm Buschs Erneuerungskünstlerin weist. Es ist aber derselbe Topos, dem wir in beiden Fällen begegnen, er wandert durch die Jahrtausende, seine Spuren finden wir überall. Bei Goethe, wenn er provozierend fragt: »was können wir denn unser Eigenes nennen, als die Energie, die Kraft, das Wollen!« Oder in Ionescos Worten, bei dem wir das sicher nicht erwartet hätten: »Das Theater hat sich im Grunde (seit der Antike) nicht entwickelt.« Und es ist durchaus nicht nur die Literatur, die diese Überzeugung mit nur kurzen Unterbrechungen bis heute kontinuierlich konstatiert oder beklagt. Zum geflügelten Wort wurde etwa Alfred Whiteheads Diktum: »Die sicherste allgemeine Charakterisierung der philosophischen Tradition Europas lautet, daß sie aus einer Reihe von Fußnoten zu Platon besteht.«
Die Streiflichter mögen uns genügen. Die mehr oder weniger resignative Diagnose bewegt sich immer in dem topischen Feld, das schon der ägyptische Autor vor über 4000 Jahren abgesteckt hat. Umso mehr überrascht es, wenn erst ziemlich spät, soweit wir für ein solches Urteil hinreichen unterrichtet sind, nämlich im 5. Jahrhundert vor Christus, und zwar auf einer kleinen Landzunge des asiatischen Kontinents, man als Antidot gegen solche meist niederdrückenden Erfahrungen von Rednern, Dichtern, Philosophen eine Kunstlehre entwickelt, die dem alten Problem eine für uns überraschende Wendung gibt, auch wenn sie natürlich auf lang geübter Praxis beruhen wird. Denn weder beläßt sie es bei der Klage über die fatale Abhängigkeit von den unvermeidlichen Vorgängern, noch negiert sie, wie das spätere Epochen versuchen und der ägyptische Anonymus es sich wünscht, die unlösbare Verquickung jeder geistigen Produktivität in das von alters her immer schon Überlieferte. Die neue Doktrin gewinnt aus dem »Gebrauchten« (um noch in Buschs Terminologie zu bleiben) die Elemente zu neuem Werk und etabliert ein theoretisches Prinzip, eine neue künstlerische Spielregel, ohne die jene Diskussion über das Verhältnis des Neuen zum Alten seither nicht mehr geführt werden kann. Das geschah unter dem Druck umwälzender historischer Veränderungen, die aber wohl nötig waren.
Eine kurze Skizze möge uns das klar machen. Die Familienherrschaft, die der Tyrannis in Griechenland voraus ging, hatte ein elementares Interesse an Brauch und Sitte, am Festhalten des Altvertrauten an der Wiederholung und Verstetigung immer derselben familiären Machtverhältnisse. Die ihr folgende Tyrannis praktizierte dann schon Politik als »methodisches politisches Handeln« (Alfred Heuss), als planvolles, sachliches staatliches Agieren, in dem die Rücksicht auf die jeweils aktuellen sozialen und ideologischen Geschehnisse auch einen Wandel im Verhältnis zum Überlieferten einschloss: Dies verlor seine allesbestimmende Macht, hatte sich also unter neuen Anforderungen zu bewähren und konnte nicht einfach fortgeschrieben werden.