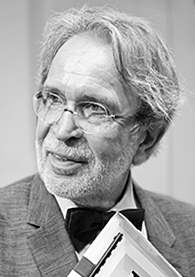Frage und Antwort
»Doch was macht man dann mit der freien Zeit?«
Theo Wehner blickt auf die Zukunft der Arbeit
Seit 1989 beschäftigt sich Prof. Dr. Theo Wehner in seiner wissenschaftlichen Arbeit mit psychologischer Fehlerforschung, dem Verhältnis von Erfahrung und Wissen, kooperativem Handel und psychologischer Sicherheitsforschung. In Wehners Forschung ist sowohl quantitatives als auch qualitatives empirisches Vorgehen zentral. Da er Arbeitgeber und Arbeitnehmer in den Blick nimmt, sind sein Forschungsergebnisse relevant für die alltägliche, betriebliche Lebenswelt – auch in der Kreativwirtschaft.
Gegenüber vergangenen Verhältnissen werde unsere tägliche Arbeitszeit immer kürzer, gleichzeitig finde eine inhaltliche Verdichtung statt. Wir entwickeln uns, so Wehner, immer mehr von einer Arbeitsgesellschaft hin zu einer Tätigkeitsgesellschaft und beginnen mehr und mehr unser eigenes Tun zu hinterfragen. Wie korrespondiert die alltägliche Arbeit mit »den eigenen Werten«? Dieser Frage stellt sich Theo Wehner im Interview und kommt zu der Ansicht, dass Arbeit nicht »Maloche« sein muss, sondern zu einem Sinn erfüllenden »Tätig-Sein« werden kann.
Wie werden wir in Zukunft arbeiten?
Die Zukunft ist unbekannt. Danach muss man einen Punkt machen. Wir sind nicht fähig, in die Zukunft zu schauen. Niklas Luhmann hat einen schönen Text geschrieben über den Nutzen der unbekannten Zukunft, und Dirk Baecker interpretiert den Sachverhalt besonders anschaulich. Warum sind wir evolutionär nicht ausgestattet, die Zukunft zu sehen? Dass wir die Zukunft nicht wahrnehmen können, ist eine Schutzfunktion. In der jüdischen Mystik sagt man, die Vergangenheit liegt vor und die Zukunft hinter einem, denn wir können sie ja nicht sehen. Wenn ich also über die Zukunft nachdenke, die hinter mir liegt, bringe ich die Vergangenheit in die Gegenwart. Günter Grass machte eine schöne Wortschöpfung, er sprach von der »Vergegenkunft«. Er vergleichzeitigte also Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Man kann also zurück in die Zukunft schauen, in dem wir das, was wir hinter uns haben, vor uns legen und dann zum Beispiel fragen: Wie ändern sich unsere Arbeitsplätze?
Die erste Antwort ist einfach: Arbeit und Arbeitsplätze haben sich immer verändert und werden auch in Zukunft nicht konstant bleiben. Doch keine Veränderung bestand jemals nur aus qualitativen Sprüngen, sondern eher aus quantitativen Zuwächsen: Schritt für Schritt. Maschinen wurden nicht von Göttern erschaffen und waren plötzlich da. Der Drang nach Automatisierung begann bereits in archaischen Kulturen und damit deutlich früher, als die Visionen der Jetztzeit dies zu suggerieren versuchen. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass Veränderungen eher inkrementell anstatt radikal, disruptiv erfolgen. In den 90er Jahren entstanden Fantasien von der menschenleeren Fabrik. Technisch wäre es machbar gewesen, warum hat man es dann nicht realisiert? Das liegt daran, dass eine menschenleere Fabrik ein ganz anderes Problem zu lösen hätte. Welcher Bezug besteht dann noch zum Produkt, zu einem Automobil etwa? Schnell wurde klar, es gibt Teile in der Montage, die wird man nie automatisieren können, und es gibt andere, die müssen schleunigst automatisiert werden.
Was sich graduell ändern wird, ist die Arbeitszeit. Wir werden weniger Arbeiten und das ganz deutlich. Wir könnten bereits heute weniger arbeiten, doch was macht man dann mit der freien Zeit? Die Versprechen der Freizeitindustrie haben sich nicht bewahrheitet. Heute ist klar, dass die Stressoren in der Freizeit mindestens so gesundheitsschädlich sind wie die am Arbeitsplatz. Refugien zu schaffen, reicht also nicht aus. Einen qualitativen Sprung sehe ich in der Entwicklung von einer Arbeitsgesellschaft hin zu einer Tätigkeitsgesellschaft. Die Erwerbstätigkeit ist nur eine Form des Tätigseins, es gibt aber dutzend weitere. Die Arbeitstätigkeit ist für uns die zentrale, die existenzsichernde Tätigkeit. Dabei sind Einkommen und Arbeit vielleicht zu eng miteinander verbunden. Diese Zwangskopplung wird sich immer stärker lockern, es wird sich ein Stück weit entflechten, so dass wir lernen, wie wir auch über andere Formen ein Auskommen generieren können. Vielleicht wird es etwas wie ein Grundeinkommen, unter Umständen gar ein bedingungsloses Grundeinkommen geben, denn dann kommen Menschen in die Situation, dass sie intrinsisch motivierten Beschäftigungen nachgehen und dabei Gestaltungsautonomie haben. Der Anspruch, eigene, subjektive Ideen in den Arbeitsprozess einfließen zu lassen, wird zunehmen; das zeichnet sich bereits heute ab und wird unter dem Begriff der Subjektivierung von Arbeit zusammengefasst.
Ausgabe Nr. 7, Herbst 2015