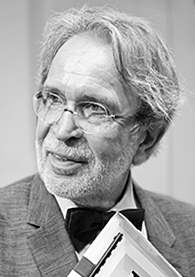Welche Auswirkungen wird das alles auf den Arbeitsmarkt und unser sozioökonomisches Handeln haben?
Globalisierung, Mobilität, all das sind keine neuen Begriffe. 1905 konnte man in Berlin am Hauptbahnhof sowohl eine Karte nach Spandau als auch eine nach Peking kaufen. Wenn ich heute nach Peking möchte, muss ich deutlich mehr Klimmzüge machen. All diese Entwicklungen waren keine qualitativen Sprünge, vielmehr haben sie sich breit, in verschiedenen Produktionsbereichen realisiert. Arbeit kann dadurch viel stärker verschoben werden, so werden zum Beispiel Arbeitsplätze in den Osten verlagert und wieder zurückgeholt werden. Wir werden virtueller arbeiten können, der Arbeitsplatz als begrenzter Raum wird sich verflüchtigen, und es wird neue Räume geben, wo wir uns physisch begegnen. Am Beispiel der Niederlande zeigt sich, das die Entwicklung hin zum »Home Office« zwingend notwendig war. Wenn alle Niederländer jeden Tag zu ihrem Arbeitsplatz per Pkw fahren würden, wäre das eine Katastrophe für dieses kleine Land. Den Arbeitsplatz mit einem festen Büro und meinem Sessel wird es in dieser Form nicht mehr geben.
Wie muss sich die schulische oder betriebliche Ausbildung von jungen Menschen verändern, um adäquat auf die Zukunft vorzubereiten?
Alle Kulturen gingen von einem Bildungsfundament aus, das man durchlaufen muss, und schlussendlich hat man, so die Vorstellung, alle Qualifikationsvoraussetzungen, die man im (Berufs-)Leben einsetzt und, so es nicht ganz reicht, durch Weiterbildungsmassnahmen nachbessern kann. In Zukunft brauchen wir ein atmendes Bildungssystem: Die Ausbildungszeiten werden verkürzt, durch viel Praxis ergänzt und zu gegebener Zeit wieder aufgenommen. Das könnte bedeuten: Man wird von sechs bis neun Jahren zur Schule gehen und hört nach drei Jahren zunächst mal auf oder macht etwas komplett anderes. Im Anschluss kann die Schule wieder aufgenommen werden, oder man wechselt zu einem anderen Lern- und Tätigkeitsbereich. Lernen wird gleichzeitig individueller und kollegialer. Um Vokabeln oder mathematische Grundkenntnisse zu lernen muss ich nicht mal mehr das Haus verlassen, ich setze mich einfach in den Garten und fange an, mir perfekt aufbereitetes Wissen mit einem »tablet« anzueignen. Wir werden hingegen gemeinsam lernen müssen, wie man ein Gespräch oder einen Disput führt. Ich muss mich in einen Streit einbringen können und lernen, eine Debatte zu beeinflussen. Genau dafür brauchen wir das Gegenüber, ich kann nicht alleine streiten, aber alleine Grammatik lernen. Alles was dialogisch, interaktiv ist, braucht soziale Lernorte – die Schule ist nur einer davon, und wenn es dort nur noch um einen guten Rangplatz beim Pisa-Test geht, dann ist er für vieles, was wichtiger wird, kein besonders guter Ort.
Brauchen wir in Zukunft mehr Generalisten oder mehr Spezialisten?
Generalisierende Spezialisten, also Personen die sehr viel monodisziplinäres Wissen haben, sehr, sehr früh aber die Grenzen ihrer jeweiligen Disziplin erkennen und Probleme durch transdisziplinäres Denken zu lösen vermögen. Interdisziplinäres Denken reicht nicht, es ist nur ein Reparaturprinzip. Transdisziplinär Denkende werden Menschen sein, die undiszipliniert sind, nur die werden die neuen Disziplinen hervorbringen. Dazu muss ich aber das eigene Fachgebiet beherrschen, denn nur dann kann ich anfangen, zu kritisieren und die Grenzen zu überwinden. Als Arbeitswissenschaftler muss ich auch Bereiche der Arbeitsmedizin, -pädagogik etc. begriffen haben, um mein Fach wirklich fundamental kritisieren und letztlich bereichern zu können. Es wird nicht so sein, dass die Dichotomie »Generalist versus Spezialist« Bestand haben wird, es werden generalisierende Spezialisten sein oder sich spezialisierende Generalisten.
Wohin wird sich in der Zukunft der Schwerpunkt ihrer Forschung verlagern, wie wird sich ihr Forschungsgebiet verändern?
Die gesamte Wissenschaft wird sich verändern. Wenn ich mich heute in ein neues Gebiet einarbeite, dann suche und lese ich wochenlang »abstracts« und Artikel. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Forschungsergebnisse sich soweit algorithmieren lassen, dass ich ein Suchprogramm anwenden kann, um herauszufinden, welche Studien sich etwa mit dem Sinnerleben in der Arbeit befasst haben und auch gleichzeitig die Desiderate herausarbeitet. Den Wissenschaftler braucht es dann für den schöpferischen Teil: Welche Theorien müssen herangezogen werden, welches Untersuchungsdesign braucht es, um die offenen Fragen zu beantworten?
Was wird sich in ihrer eigenen Forschungsarbeit verändern?
Nicht nur in der eigenen Disziplin tiefer bohren zu wollen, nicht nur konvergentes Wissen zu produzieren, sondern auch divergentes Wissen für die Praxis bereit zu stellen – wir müssen viel mehr in die Wissensbreite gehen. Im Moment sind wird noch sehr damit beschäftigt, mit noch mehr Variablen die zwölfte Dezimale des eigenen Fachs, eines Motivationsmodells etwa, herauszufinden; und dabei gehen uns die ganzzahligen Anteile, z. B. die Praxisrelevanz verloren. Das wird die Zukunft nicht brauchen.
Welche ist ihre größte Angst vor der Zukunft?
Das mag überheblich klingen, aber ich habe keine Angst vor der Zukunft. Da sie unbekannt ist, sehe ich darin eher eine Chance, erlebe eher das Gegenteil von Angst: Ich werde staunend die nächsten Erkenntnisse wahrnehmen und lernen, sie in kleinen Schritten, hin zu einer sich weiterentwickelnden Gesellschaft umzusetzen. Die Ängste vor der menschenleeren Fabrik oder vor der Globalisierung basieren für mich auf fehlender Aufklärung. Wir haben versäumt die Menschen mitzunehmen und zu zeigen, dass es kein Gewinn-Verlust-Spiel ist, sondern dass etwas vielleicht jetzt gerade opportun ist, sich in Zukunft aber auch in eine komplett andere Richtung wenden kann: zwei Schritte vor, einen zurück, unter Umständen auch drei! Nur wenn Verabsolutierungen, Vereinseitigungen und unkritische Verlängerungen von Trends nicht relativiert werden, lösen sie Ängste aus. Müsste ich Ängste formulieren, bezögen sie sich viel mehr auf die gegenwärtige Gesellschaftsentwicklung. Viele jetzt geborene werden in manchen Ländern, Russland zum Beispiel, nicht mehr so alt wie ihre Eltern. Jeder fünfte Mensch der kommenden Generationen hat im Laufe seines Lebens vier bis fünf depressive Attacken. Auch das ängstigt mich nicht persönlich, da ich glaube, genügend soziale Einbindung und Selbstwirksamkeit zu haben, so dass es mich nicht trifft. Vielleicht ist es aber auch einfach nur unrealistischer Optimismus. Auf gesellschaftlicher Ebene ängstigt mich, dass nicht wahrgenommen wird, was das bedeutet. Mit Hysterikern konnte man noch relativ gut leben. Bis ins frühe zwanzigste Jahrhundert führten überfordernde Arbeitsbedingungen eher zu hysterischem Verhalten. Man schlug mit der Faust auf den Tisch, es flogen Kaffeetassen durch die Kantine. Der depressive Mensch erlebt nicht nur keinen Antrieb, sondern keine Resonanz mit seiner Umwelt, das ist beängstigend für uns alle.
Ausgabe Nr. 7, Herbst 2015