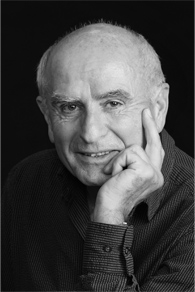Dritte Möglichkeit der Bearbeitung ist der Austausch der Bestandteile innerhalb des gegebenen Kontextes und ändert Schwerpunkt, Gewicht und Ansehen der Rede.
Mit der vierten Technik tauscht der Autor hier und jetzt unbrauchbare Elemente gegen solche aus fremden, möglicherweise nach Inhalt, Zeit oder Ort weit entfernten Kontexten aus. Andere Verfahrensweisen laufen auf die Konstruktion des völligen Gegenteils, auf die ironische Zweideutigkeit, ja sogar auf die totale Identifikation hinaus, die einer Fälschung gleich kommt. Für letztere hat der argentinische Schriftsteller und übrigens intime Kenner der Rhetorik Jorge Luis Borges uns das Exempel des Grenzfalls der Imitatio vor Augen geführt, und zwar in seiner Geschichte »Pierre Menards, des Autors des Quijote«.
Jener Menard, der im 1. Drittel des 20 Jahrhunderts leben sollte, hatte sich das folgende wahnwitzige Projekt vorgenommen: »Er wollte nicht einen anderen Quijote verfassen, was leicht ist -, sondern den Quijote. Unnütz hinzuzufügen, daß er keine mechanische Übertragung des Originals ins Auge faßte; einer bloßen Kopie galt nicht sein Vorsatz. Sein bewundernswerter Ehrgeiz war vielmehr darauf gerichtet, ein paar Seiten hervorzubringen, die – Wort für Wort und Zeile für Zeile – mit denen von Miguel de Cervantes übereinstimmen sollten.«
Auch den Aufwand, den das Vorhaben bedeutete, skizziert Borges, nennt es ironisch eine »verhältnismäßig einfach(e)« Methode: »Gründlich Spanisch lernen, den katholischen Glauben wiedererlangen, gegen die Mauren oder gegen die Türken kämpfen, die Geschichte Europas im Zeitraum zwischen 1602 und 1918 vergessen, Miguel de Cervantes sein. Pierre Menard ging diesem Verfahren auf den Grund (ich weiß, daß er es zu einer recht getreuen Handhabung der spanischen Sprache des 17. Jahrhunderts brachte), schob es aber als zu leicht beiseite … Im zwanzigsten Jahrhundert ein populärer Schriftsteller des 17. Jahrhunderts zu sein, kam ihm wie eine Herabminderung vor. Auf irgendeine Art Cervantes zu sein und zum Quijote zu gelangen, erschien ihm weniger schwierig – infolgedessen auch weniger interessant – als fernerhin Pierre Menard zu bleiben und – durch die Erlebnisse Pierre Menards – zum Quijote zu gelangen.«
Der Erzähler, gebannt von der kühnen Idee Menards beginnt den Roman zu lesen, entdeckt schnell kleine Widersprüche, übersehene Anspielungen, beiläufige Ungereimtheiten, die niemals einem Autor des 17. Jahrhunderts passieren konnten, sondern offenbar auf Pierre Menards Konto gehen. Vor seinen Augen tauschen Menard und Cervantes die Gesichter und der Text verwandelt sich in ein Buch des Pariser Schriftstellers und Borges-Zeitgenossen, der sich bis auf kleine indizienhafte Fehler oder Ausrutscher vollkommen in sämtliche Verhältnisse jener vergangenen Epoche und ihres fiktiven Autors namens Cervantes hineingedacht, hineingeschrieben hat. Borges beendet sein labyrinthisches Experiment mit einer überraschenden Nutzanwendung: »Menard hat (vielleicht ohne es zu wollen) vermittels einer neuen Technik die abgestandene und rudimentäre Kunst des Lesens bereichert, nämlich durch die Technik des vorsätzlichen Anachronismus und der irrtümlichen Zuschreibungen. Diese unendlich anwendungsfähige Technik veranlaßt uns, die Odyssee so zu lesen, als wäre sie nach der Aeneis gedichtet worden, und das Buch ›Le Jardin du Centaure‹ von Madame Henri Bachelier so, als wäre es von Madame Henri Bachelier. Diese Technik erfüllt mit abenteuerlicher Vielfalt die geruhsamsten Bücher. Wie, wenn man Louis Ferdinand Céline oder James Joyce die ›Imitatio Christi‹ zuschriebe: hieße das nicht, diese dünnblütigen geistlichen Anweisungen hinlänglich mit Erneuerungskraft begaben?«
Bevor Sie, meine Damen und Herren, sich hoffnungslos in diesem Spiegelkabinett verfangen, oder es gar als eine müssige literarische Spielerei abtun, möchte ich Sie an die Erfindung des wahren Ossian durch den Schotten MacPherson oder die Entdeckung Thomas Chattertons von der Dichtung eines bis dato unbekannten Mönchs aus dem 15. Jahrhundert erinnern. Auch einen deutsch-elsässischen Autor kann ich in diese Reihe stellen, sein Name George Forestier, sein schmales Werk besteht aus einigen hochgelobten Gedichtbändchen aus seiner Legionärszeit, die man fälschlicherweise später einem Karl Emerich Krämer zuschrieb. Ein Fremdenlegionär wird ja wohl kaum so heißen!
Auch an Ihre Erinnerung an eine seinerzeit recht spektakulär erlebte künstlerische Imitatio möchte ich in unserem Zusammenhang appellieren. Das alltägliche Gepräge des dabei verwendeten Gegenstands verdeutlicht das Verfahren. Als Andy Warhol 1962 seine Campbells-Suppendosen in einer berühmten Serigraphie publizierte und signierte, verurteilte er im selben Zuge alle bisherigen und alle späteren Exemplare zu millionenfachen Kopien seines Originals. Eine besondere Volte in der Ästhetik der Imitation verdanken wir aber Arno Schmidt, der die »Wirkliche Welt« zur »Karikatur unsrer Großn Romane« erklärte. Womit er gleichsam nebenbei einen populären Schein-Unterschied zwischen künstlerischer und rhetorischer »imitatio«, also zwischen »imitatio naturae« und »imitatio artis« beseitigte. Das hatte vorher zwar schon Friedrich Nietzsche getan, der jedes Abbild, also auch das der Natur als metaphorische, nämlich sprachliche Operation analysierte, aber das Ergebnis nicht mit der entwaffnenden Chuzpe präsentierte, wie das der Autor von »Zettels Traum« dann tun sollte.
Doch halt! Ich bin, das Schema der rednerischen »dispositio« nun selber »per adiectionem« erweiternd, meinem Gedankengang etwas vorausgeeilt. Denn bevor man die Methoden der Veränderung anwenden und etwa aus dem Volksbuch vom Doktor Faustus ein Weltdrama machen kann, muß zuvor die Frage geklärt werden, was zur Nachahmung sich eigentlich anbietet, wie schöpferisch sie dann auch immer mit dem Vorbild umgehen mag. Dass eine Auswahl getroffen werden muß, liegt angesichts der schieren Menge des Gebrauchten auf der Hand – einen kleinen Hinweis in die richtige Richtung können wir sogar aus den Versen Wilhelm Buschs lesen. Nicht ohne Grund nämlich hat er für seine lyrische Parabel den »Schwalbenschwanz«, die festliche Garderobe, nicht die Arbeitskluft, herbeizitiert.
Doppelausgabe Nr. 8 und 9, Herbst 2016