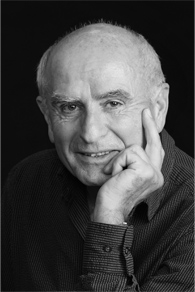Jens beschreibt die Verhältnisse einer Epoche, in denen allerdings die Übereinkunft in Bildungsangelegenheiten brüchig geworden war und auch in den bürgerlichen Trägerschichten nicht mehr fraglos galt. Die Ursachen dafür liegen vielleicht zwei, höchstens drei Generationen zurück, besonders krass ausgeprägt in der Geniebewegung des späten 18. Jahrhunderts. Ihr kommt das fragwürdige Verdienst zu, die innere Dialektik von Nachahmung und Überbietung zugunsten der Idolatrie von Originalität aufgehoben zu haben. Im 19. Jahrhundert verlangsamte sich der Umbruch zwar wieder, auch belebten sich ältere Bildungsideen erneut, aber doch nur kurzfristig; sie erwiesen sich als Vorstufe zu dem heutigen unbefriedigenden Zustande scheinbar grenzenloser Lizenzen.
Wenn wir die Erfindung der Originalität, ja dass sie überhaupt eine Erfindung ist, verstehen wollen, scheint mir ein Seitenblick auf die Buchproduktion im Zeitalter der Aufklärung unumgänglich. Dessen Kommerzialisierung folgt der Entwicklung der allgemeinen Wirtschaftsverhältnisse, das ist bekannt. Ausweitung des Lesepublikums, tendenzielle Veränderung der Lektüre zur Massenkommunikation, die Lösung des Schriftstellers aus ständischer Sicherheit und seine Abhängigkeit von den Mechanismen des Marktes, so lauten die entsprechenden historischen Schubladen. Wenn sie die wirklichen Phänomene auch nur sehr abstrakt beschreiben, Ungleichzeitigkeiten oder Verschiebungen nicht berücksichtigen, in großer Linie treffen sie zu, und Zeitgenossen wie Wieland und Goethe haben es schon so gesehen. »Der Buchhandel bezog sich in früherer Zeit«, erinnert Goethe, »mehr auf bedeutende, wissenschaftliche Fakultätswerke, auf stehende Verlagsartikel, welche mäßig honoriert wurden. Die Produktion von poetischen Schriften aber wurde als etwas Heiliges angesehen, und man hielt es beinah für Simonie, ein Honorar zu nehmen oder zu steigern.« Noch als Klopstock, Lessing, Nicolai durch Verlagsgründungen der Schriftstellerei eine solide ökonomische Basis zu geben versuchten, war die Meinung weit verbreitet, dass der Autor »überhaupt kein Honorar nehmen« solle, das »Bücherschreiben sei einmal kein Broterwerb«.
Im Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion stand daher eine Zeitlang nicht der Autor, sondern der Buchhändler. Der war der eigentliche Verdiener. Das Buch hatte er vom Verfasser gekauft, es war damit in seinen Besitz übergegangen, und wenn der Autor überhaupt ein Honorar erhielt, war er damit auch ausbezahlt, erhielt für weitere Auflagen nichts. Dieses eingeschränkte Eigentumsrecht des Schriftstellers betraf auch den regen Nachdruckbetrieb, der ein Modethema der Epoche war. Es erklärt, warum ein Autor wie Knigge, obwohl er schon zum größten Teil von seinem Schreiben leben musste, doch zugunsten des Nachdrucks plädierte: Wenn er schon sein Eigentumsrecht verkauft und nichts weiter zu erwarten hatte, war ihm mehr an der Verbreitung seiner Ideen als am Verdienst seines Verlegers gelegen, von dem er selber aber nichts weiter zu erwarten hatte.
Ich habe schon kurz erwähnt, dass sich im Zuge dieser Veränderungen auch die Lektüregewohnheiten wandelten. Von einer »immerwährenden Neuigkeitsjägerey« sieht sich ein bayrischer Aufklärer bedroht. Die grassierende Lesesucht, die Wieland und viele andere beklagen, verlangte nach immer neuer Nahrung, man las nicht intensiv, sondern soviel wie möglich, benötigte dauernd Nachschub für die Leihbibliotheken und Lesevereine. Für die Autoren ein steter Ansporn zur Neuproduktion von neuen Büchern mit neuen, noch möglichst unbekanntem Inhalt. An ihrer prekären sozialen Stellung änderte das zunächst nichts, wohl aber an ihrem Verhältnis zur Tradition, auf die sich zurückzubeziehen keinen Erfolg mehr versprach. Noch einmal Goethe: »Nun sollte aber die Zeit kommen, wo das Dichtergenie sich selbst gewahr würde, sich seine eigenen Verhältnisse selbst schüfe, und den Grund zu einer unabhängigen Würde zu legen verstände. Alles traf in Klopstock zusammen, um eine solche Epoche zu begründen.«
Nicht vergessen dürfen wir in diesem Zusammenhang den Ursprung des Eigentumsrechts im revolutionären Frankreich, das sich auch des geistigen Eigentums versicherte. Es war (ausgerechnet, könnte man ausrufen) Preußen, das in seinem Landrecht zum ersten Mal in der deutschen Geschichte das Urheberrecht verankerte, und zwar schon zu Beginn der 90iger Jahre. Nimmt man alles zusammen, so basiert die Erfindung und Karriere des Originalitätsbegriffs auf zwei Grundsätzen der neuen Epoche: auf der Veränderung der Lesegewohnheiten im Zuge beginnenden Massenkonsums und auf dem unverbrüchlichen Recht des Schriftstellers an seinem Original-Werk. Dessen Ausweis als einzigartig und vorraussetzungslos begründete schließlich alle ökonomischen Ansprüche, fungierte sozusagen als Marken-Produkt-Zeichen.
Und die Nachahmung, werden wir uns jetzt fragen, hatte sie ausgedient? Schöpfte der Autor jetzt nur noch aus sich selbst oder direkt aus der Natur? Emanzipierte er sich von Einfluß, gar Zwang der Vergangenheit? War er endlich frei und selbständig geworden? Die meisten Dichter hängten sich diese Etiketten um, sie stellten sich schnell als Schwindel heraus. Friedrich Maximilian Klinger, der einst mit seinem Drama »Sturm und Drang« der Bewegung in Deutschland einen Namen gegeben hatte, bemerkte später realistisch: »Das Publikum kann freilich zu seinen Schriftstellern sagen: ›Ihr steht in unserm Solde!‹ Die meisten könnten aber dem Publikum sagen: – so dienen wir dir auch!« Auch im übrigen herrschten Selbsttäuschung und Werbungssprüche. Die Autoren, denen man nachfolgen wollte, hießen nicht mehr Cicero oder Horaz, sondern Shakespeare, oder es waren die anonymen Urheber der nordischen Poesie, die Herder übersetzte. Dass Shakespeare, wenn auch auf andere Weise, aber ebenso fest in der rhetorischen Tradition fußte wie Horaz oder Vergil oder der geschmähte Corneille, dafür hatte niemand einen Sinn. Auch nicht dafür, dass Goethes »Werther« ein ausgeklügeltes Produkt feinster Affektrhetorik war, kein Naturprodukt.
Doppelausgabe Nr. 8 und 9, Herbst 2016