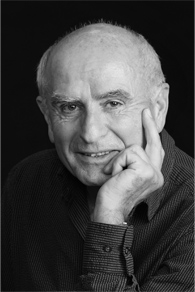Warum verfährt sie derart aufwendig und dementiert eigentlich die rationale Bestimmung ihrer Institutionen? Weil diese Imitatio nicht formal bleibt, wie in vielen literarischen Beispielen, sondern Bedürfnisse erfüllt, die unbefriedigt der neuen Herrschaft gefährlich werden könnten. Ein anderes Beispiel erleben wir täglich in unseren Museen. In der Zeit, in der die Kunst ihre lebensdienliche Macht längst verloren hat, stürmt das Publikum in solchen Massen die Galerien, dass es dasjenige gefährdet, was es aufsucht. Warum nur? muss man sich fragen, und tatsächlich kommt hier ein Motiv ins Spiel, das bisher nur gelegentlich einmal anklang. Nachahmung ist über ihre Funktion der Qualitätssicherung, besser Qualitätssteigerung hinaus, auch ein Instrument der Erinnerung, der Kanon ein Ort des kollektiven Gedächtnisses. In diesem Verständnis hat man schon früh den Dichter »janusköpfig« genannt, er blicke nämlich »voraus und zurück, scheide das Falsche vom Wahren, vergleiche das Künftige mit dem Vergangenen«. Das Originelle als isolierter Selbstzweck entbehrt vollkommen dieser für die menschliche Geschichte wesentlichen Dimension. Der vollkommenste Ausdruck des isoliert Originellen ist die Mode, in welcher Walter Benjamin die ewige Wiederholung des Neuen gesehen hat.
Womit ich zum Schluss auf eine Dimension des hier erörterten Themas komme, das nun weit die produktionstechnischen Fragen hinter sich läßt, obwohl sie in ihnen durchaus zu erkennen sind. Denn es waren geschichtliche Stationen, die der Kanon markierte und zur Erneuerung zur Verfügung stellte, nicht etwa bloß museal präsentierte. Seine Entstehung aus der imitatio-Doktrin und seine Verpflichtung auf die jeweils zur Debatte stehende Handlungswirklichkeit wirkte wie ein Ferment auf und in der alten familienrechtlich fixierten Gedächtniskultur. Deren retrospektive Richtung verweist auf ihre Entstehung aus dem Totenkult. Eine vielzitierte Anekdote berichtet davon. Ich will sie Ihnen nicht vorenthalten.
Der berühmte Redner und Dichter Simonides von Keos der im 5. Jahrhundert lebte und in Athen wirkte, hatte von einem reichen Faustkämpfer den Auftrag erhalten, ein Preislied auf dessen Sieg in einem Wettkampf zu verfassen. Simonides trug das Lied während eines Gastmahls vor, doch war der Auftraggeber unzufrieden, da der Dichter sich zur Ausschmückung recht fleißig des Lobes von Kastor und Polydeukes bediente. Simonides erhielt nur die Hälfte des Honorars: »Die andere Hälfte hol dir gefälligst von den Dioskuren, die du so ausführlich gelobt hast!«, höhnte der Olympia-Sieger. Die Götter ließen sich nicht lumpen, allerdings anders als gedacht. Jedenfalls wird weitererzählt, daß Simonides bei fortgeschrittenem Mahl vor die Tür gebeten wurde, zwei Männer begehrten ihn zu sprechen. Er ging hinaus, fand niemanden, doch bevor er sich wieder zurückwenden konnte, stürzte hinter ihm der Festsaal zusammen. Die Trümmer begruben alle Anwesenden unter sich, verstümmelten sie bis zur Unkenntlichkeit, so daß die Verwandten, die ihre Toten begraben wollten, in Verlegenheit gerieten. Doch da sich Simonides erinnerte, an welcher Stelle jeder einzelne gesessen hatte, war schließlich doch noch eine Identifikation möglich. Cicero, der den legendären Fall berichtet, schließt mit dem Resümee: »Durch diesen Vorfall aufmerksam gemacht, machte er (Simonides) damals ausfindig, daß es besonders die Ordnung sei, die dem Gedächtnis Licht verschaffe.«
Das Gedächtnis, so die zweite Botschaft der Geschichte, dient dem Andenken der Toten. Die Lebenden begruben sie um der Erinnerung willen, und aus diesen Riten erwuchsen die Institutionen, die Giambattista de Vico, der neapolitanische Rhetorik-Philosoph, so präzise ordini nennt, die Ordnungen der Überlieferung also, die sich in Geschichtsschreibung oder Bibliothekswesen, in Denkmalskunst oder Museen manifestierten. Sie sind Ausdruck einer Gedächtniskunst, einer ars memorativa, bekanntlich immer schon ein Teil der Redekunst; mit ihrer Hilfe prägte sich der Redner seine Rede im Gedächtnis ein. Simonides soll daraus ein florierendes Geschäft als Gedächtnistrainer gemacht haben. Eines Tages aber habe er dem Politiker Themistokles seine Dienste angeboten, so berichtet eine andere Anekdote, und sich eine Abfuhr eingehandelt. Denn, antwortete ihm der versierte Redner geradezu entsetzt, er brauche keine Gedächtniskunst, sondern im Gegenteil eine Kunst des Vergessens, ars oblivionis, weil sein natürliches Erinnerungsvermögen derart vollkommen geartet sei, dass nichts, was er einmal gehört oder gesehen habe, wieder von ihm losgelassen und vergessen werden könne.
Doppelausgabe Nr. 8 und 9, Herbst 2016