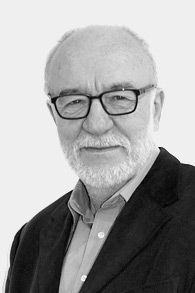XI. Revolution durch Wahrnehmen
Tatsächlich scheint nicht nur im Bereich des unmittelbaren Wahrnehmens der sinnlich zugänglichen Welt, sondern auch auf einer höheren – geistigen – Ebene die gebildete Gestalt eine Rolle zu spielen, wobei diese Verbindung es zwanglos erlaubt, den Übergang von der Physiologie bzw. Psychologie in die Wissenschaftstheorie zu vollziehen. Der Hinweis auf diese Möglichkeit findet sich bei Thomas Kuhn, der in seiner berühmt gewordenen Analyse über »Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen« von 1962 den Hinweis gegeben hat, daß zumindest im Verlauf eines Umbruchs wissenschaftliches Denken an Bilder geknüpft ist. Zu Beginn von Kapitel X, das die Überschrift »Revolutionen als Wandlungen des Weltbildes« trägt, kann man lesen:
»Während der Revolutionen sehen die Wissenschaftler neue und andere Dinge, … Paradigmenwechsel veranlassen die Wissenschaftler tatsächlich, die Welt ihres Forschungsbereichs anders zu betrachten. […] Als elementare Prototypen für solche Veränderungen der Welt des Wissenschaftlers erweisen sich die vertrauten Darstellungen eines visuellen Gestaltwandels geradezu als suggestiv. Was in der Welt des Wissenschaftlers vor der Revolution Enten waren, sind nachher Kaninchen. Ein Mensch, der zuerst die Außenseite eines Kastens sieht, erblickt später von unten die Innenseite.«
Die von Thomas Kuhn erwähnen Bilder stellen Beispiele für die bekannten Kipp-Figuren dar, wobei der als zweites erwähnte Kasten gewöhnlich als Necker-Würfel vorgestellt wird, der als zweidimensionale Darstellung eines dreidimensionalen Gebildes die erwähnte Doppeldeutigkeit zuläßt. Im ersten Fall muß ein Betrachter sich entscheiden, eine längere gewundene Linie entweder als Schnabel einer Ente oder als Ohrenpaar eines Kaninchens zu interpretieren.
Kuhn meint, daß ein Wissenschaftler »zur Zeit einer Revolution … eine neue Gestalt sehen lernen« muß. Der Wissenschaftshistoriker führt als ein Beispiel den Blick auf den Himmelskörper namens Uranus an, der zunächst als Stern und erst nach 1781 durch die Augen von Sir William Herschel als Planet gesehen wurde, und er führt als weiteres Beispiel die Entdeckung des Sauerstoffs an, die er dem Franzosen Antoine Lavoisier zuschreibt, der – etwa zur selben Zeit wie Herschel im späten 18. Jahrhundert – durch eine neue Theorie der Verbrennung etwas »sehen konnte«, was sein Konkurrent, der Brite John Priestley, »bis ans Ende seines langen Lebens nicht zu sehen vermochte«, daß es nämlich einen Stoff (ein Gas) gab, der durch eine Verbrennung aus der Atmosphäre entfernt wird.
In diesem letzten Beispiel taucht der Gedanke auf, daß das Sehen eines Menschen theoriegeleitet ist, wie man heute sagen würde. Tatsächlich wird hiermit eine allzu bekannte Beobachtung ausgedrückt, die eine weite Verbreitung durch den von Goethe inspirierten Werbespruch eines Herstellers von Reiseführern bekommt, der für seine Produkte wirbt, indem er mahnt, »Man sieht nur, was man weiß«.
Thomas Kuhn erwähnt dieses Problem ebenfalls, wenn er schreibt: »Beim Blick auf ein Glaser-Kammer-Photo sieht der Studierende verworrene und unterbrochene Linien, der Physiker aber sieht die Aufzeichnung eines bekannten subnuklearen Vorgangs. Erst nach einer Anzahl solcher Umwandlungen des Sehbildes wird der Studierende ein Einwohner der Welt des Wissenschaftlers, der sehen kann, was der Wissenschaftler sieht.«
Dieser fast selbstverständliche Zusammenhang wird hier nur erwähnt, weil er auch in eine ganz andere Richtung gesucht werden kann und erreicht worden ist. Gemeint ist die Tatsache, daß Bilder der von Kuhn erwähnten Art, die zuerst mit Hilfe der Nebelkammern (1912) und anschließend durch Aufnahmen aus Blasenkammern einen Einblick in die Teilchenwelt zuließen, etwa zeitgleich mit dem Entstehen der modernen – also gegenstandslosen – Malerei aufgekommen sind, was nicht als Zufall beiseite geschoben werden kann und zum Beispiel mit großem Interesse von Künstlern des Blauen Reiters – allen voran Wassilij Kandinsky – verfolgt worden ist.
XII. Die Bilder und die Theorien
Die Rolle der Bilder bei der Errichtung von Theorien gehört leider nicht zu den bevorzugten Themen, mit denen sich die Theoretiker und Philosophen der Wissenschaft betätigen, obwohl im Rahmen von Forschungsberichten oft genug vom neuen Bild des Atoms oder der Evolution die Rede ist, das man sich macht bzw. das dem Publikum vermittelt wird. Im Nachdenken über die möglichen Fortschritte auf dem Wege der Wissenschaft hat die »Logik der Forschung« mit ihrem vermuteten Wechselspiel aus Hypothese und Falsifizierung immer noch klar den Vorrang vor dem gefühlsbegleiteten Aufscheinen der Bilder. Dabei kann sich von dieser eher hilflosen Ansicht lösen, wer zum einen bereit ist, die Geschichte der Wissenschaft hinreichend zur Kenntnis zu nehmen, und wer zum zweiten für die Idee offen ist, daß der gründlichen Rationalität des Verstandes nicht diese Rationalität selbst, sondern etwas anderes als sie vorangegangen sein kann und muß – und dieses andere könnte etwas Bildhaftes, etwas sinnlich Gebildetes und damit ein inneres Bild gewesen sein.
An dieser Stelle kommt uns zu Hilfe, daß einer der ganz Großen der Physik unseres Jahrhunderts genau in dieselbe Richtung gedacht hat, und zwar der 1945 mit dem Nobelpreis für sein Fach ausgezeichnete Wolfgang Pauli, der neben theoretisch-physikalischen Arbeiten auch zahlreiche persönliche Briefe im Sinne eines kritischen Humanismus geschrieben hat. Diese ursprünglich privaten Texte sind seit wenigen Jahren im Rahmen wunderbarer und sorgfältig edierter Briefeditionen umfassend und allgemein zugänglich, und sie gehören zu den großen Fundgruben der europäischen Kultur, die Lesestoff für ein langes Leben bieten.[15]
Ausgabe Nr. 22, Frühjahr 2023