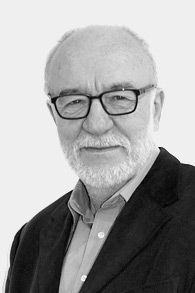Wir können nur auf winzigste Bruchstücke des Schatzes hinweisen und zum Beispiel Paulis Ansicht zur Entstehung wissenschaftlicher Theorien zitieren, die zur Überraschung der meisten Wissenschaftsphilosophen betont, was praktizierenden Physikern wahrscheinlich eher selbstverständliche Gewißheit sein wird, daß physikalischen Theorien nämlich gerade nicht durch logische Schlüsse aus Protokollbüchern abgeleitet werden. Sie kommen – Pauli zufolge – vielmehr »durch ein vom empirischen Material inspiriertes Verstehen« zustande, welches er »als zur Deckung kommen von inneren Bildern mit äußeren Objekten und ihrem Verhalten« präzise beschrieben hat, wobei natürlich diese äußeren Objekte erst einmal selbst von der Wahrnehmung in Bilder umgewandelt werden müssen.
Bemerkt hatte Pauli dieses Zusammenpassen und Übereinstimmen von Bildern nicht nur im Verlauf seiner eigenen wissenschaftlichen Entdeckungen, sondern vor allem bei der historisch-kritischen Analyse der Werke und Argumente von Johannes Kepler, der sich im 17. Jahrhundert den heliozentrischen Vorschlag des Kopernikus zu eigen machte, indem er die Sonne endgültig in die Mitte der Welt setzte und die Erde um sie kreisen ließ. Das Studium der Schriften von Kepler läßt dabei erkennen, daß er diese kosmische Überzeugung nicht aus wissenschaftlich nachprüfbaren, sondern aus religiös motivierten Gründen gewonnen hat. Kepler besah den Himmel vor dem Hintergrund eines besonderen Bildes, das den dreifaltigen Gottes repräsentiert und von ihm selbst als Dreieinigkeit bzw. Trinität verstanden wurde. Für Kepler stellt die Trinität ein Urbild des Denkens dar, wobei er das lateinische Wort »archetypus« verwendet, das heute Eingang in die Psychologie gefunden hat und den Kreis zu Paulis eigenem Denken schließen wird. Indem das heliozentrische Weltbild das archetypische Bild der Trinität perfekt spiegelt bzw. repräsentiert, ist Kepler in der Lage, die Gesetzen des Himmels zu erkennen. Er selbst hat sich im frühen 17. Jahrhundert schon in seinen ersten Schriften entsprechend geäußert und eine Erkenntnistheorie der Bilder formuliert:
»Erkennen heißt, das sinnlich (äußerlich) Wahrgenommene mit den inneren Urbildern zusammenzubringen und ihre Übereinstimmung zu beurteilen, was [man] sehr schön ausgedrückt hat mit dem Wort, ›Erwachen´ wie aus einem Schlaf. Wie nämlich das von außen Begegnende uns erinnern macht an das, was wir vorher wußten, so locken die Sinneserfahrungen, wenn sie erkannt werden, die intellektuellen und innen vorhandenen Gegebenheiten hervor, so daß sie dann in der Seele aufleuchten«, wobei dieser zuletzt genannte Vorgang nur die Umschreibung Keplers für sein Glücksgefühl ist, das in diesem Zusammenhang auch als physikalischer Rausch beschrieben werden kann.
Die »innen vorhandenen Gegebenheiten« kennt die heutige Psychologie als präexistente innere Bilder, und die Befriedigung bzw. das Glücksgefühl, daß sich mit der Bewußtwerdung einer neuen Einsicht einstellt, kann dadurch beschrieben werden, daß es zu einer Deckung dieser inneren Bilder mit denjenigen kommt, die von außen gekommen sind und nun in dieser Festlegung als Vorstufe der Begriffsbildung dienen können.
Kepler vermutet übrigens, daß es geometrische Formen sind, mit denen die Urbilder gemalt werden. Diesen Gedanke, den man wegen seiner formalen Nähe zu den geschilderten Entdeckungen der Neurophysiologie des Sehens nur sympathisch finden kann, hat Kepler nicht nur zu seinem zentralen Satz der Ästhetik genutzt, demzufolge die Geometrie das Urbild der Schönheit der Welt ist (»Geometria est archetypus pulchritudinis mundi«). Er hat aus ihm auch sein wissenschaftliches Glaubensbekenntnis formuliert, indem er konstatierte, »die Geometrie ist Gott selbst, und sie hat ihm die Urbilder geliefert für die Erschaffung der Welt. In die Menschen aber, Gottes Ebenbild, ist die Geometrie übergegangen, und nicht erst durch die Augen wird sie aufgenommen.«
Sie wird natürlich auch durch die Augen aufgenommen, und Erkenntnis findet in dem ästhetischen Akt statt, bei dem die sinnlich erzeugten Innenbilder mit den seelisch hervorgerufenen Innenbildern harmonisieren.
XIII. Der archetypische Hintergrund
Die Idee der inneren Bilder findet sich bereits vor gut 100 Jahren bei dem Physiker Heinrich Hertz, der seine Vorlesungen über die »Prinzipien der Mechanik« von 1894 damit eröffnet:
»Wir machen uns innere Scheinbilder oder Symbole der äußeren Gegenstände, und zwar machen wir sie von solcher Art, daß die denknotwendigen Folgen der Bilder stets wieder die Bilder seien von den naturnotwendigen Folgen der abgebildeten Gegenstände. Damit diese Forderungen überhaupt erfüllbar sei, müssen gewisse Übereinstimmungen vorhanden sein zwischen der Natur und unserem Geiste.«
Hertz äußert sich leider nicht weiter, wie diese »gewissen Übereinstimmungen« seiner Ansicht nach aussehen bzw. zustande kommen könnten. Für Pauli liegt – ein halbes Jahrhundert später – die Antwort in dem Konzept, daß die moderne Psychologie mit dem schon von Kepler verwendetet Begriff als Archetypen bezeichnet. Wie mit dessen Hilfe und den dazugehörigen inneren Bildern psychologische fundierte Theorie der Erkenntnis zu skizzieren ist, versucht Pauli zunächst in einem Brief vom 7. Januar 1948, der an seinen Kollegen Markus Fierz gerichtet ist, darzustellen. Er schreibt:
»Wenn man die vorbewußte Stufe der Begriffe analysiert, findet man immer Vorstellungen, die aus ´symbolischen´ Bildern mit im allgemeinen starkem emotionalen Gehalt bestehen. Die Vorstufe des Denkens ist ein malendes Schauen dieser inneren Bilder, deren Ursprung nicht allgemein und nicht in erster Linie auf Sinneswahrnehmungen zurückgeführt werden kann. Die archaische Einstellung ist aber auch die notwendige Voraussetzung und die Quelle der wissenschaftlichen Einstellung. Zu einer vollständigen Erkenntnis gehört auch diejenige der Bilder, aus denen die rationalen Begriffe gewachsen sind.«
Zu einer vollständigen Theorie des Erkennens gehört natürlich vor allem eine Beschreibung der Brücke, die zwischen den äußeren Wahrnehmungen und den inneren Ideen vermittelt und beide Bereiche ordnet und reguliert, wie Pauli es gerne nennt. Für diese Stelle nun benötigt er das Konzept das »Archetypus«, wobei er als Wissenschaftler im 20. Jahrhundert eine Schwierigkeit zu überwinden hat, die für Kepler noch nicht bestand. Es geht um die von René Descartes eingeführte und in der westlichen Wissenschaftssprache längst fest verankerte Trennung der geistigen und der materiellen Sphäre (res cogitans und res extensa). Wer Außen und Innen in einem Punkt verbinden will – ohne dabei von einer Seele sprechen zu wollen –, muß den kartesischen Schnitt aufheben und wieder eine Ebene finden, von der aus die Welt als Ganzes zu sehen ist. Auf dieser Ebene sind die Archetypen angesiedelt. In den Worten von Pauli:
»Das Ordnende und Regulierende muß jenseits der Unterscheidung von ›physisch‹´ und ›psychisch‹ gestellt werden – so wie Platos ›Ideen‹ etwas von Begriffen und auch etwas von Naturkräften haben (sie erzeugen von sich aus Wirkungen). Ich bin sehr dafür, dieses ›Ordnende und Regulierende‹ ›Archetypen‹ zu nennen; es wäre dann aber unzulässig, diese als psychische Inhalte zu definieren. Vielmehr sind die erwähnten inneren Bilder die psychische Manifestation der Archetypen, die aber auch alles Naturgesetzliche im Verhalten der Körperwelt hervorbringen, erzeugen, bedingen müßten. Die Naturgesetze der Körperwelt wären dann die physikalische Manifestation der Archetypen. Es sollte dann jedes Naturgesetz eine Entsprechung innen haben und umgekehrt, wenn man auch heute das nicht immer unmittelbar sehen kann.«
Ausgabe Nr. 22, Frühjahr 2023