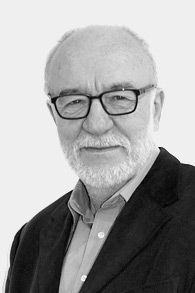Als zentrale Aufgabe einer Erkenntnistheorie der Wissenschaft, die über den logisch-rationalen Grundkurs hinausgeht, sieht Pauli die Erkundung des archetypischen Hintergrunds, den grundlegende Begriffe der Physik haben. Für ihn stellen zum Beispiel das Atom und die Energie weder empirisch noch logisch fundierte Begriffe dar – und aus heutiger Sicht könnte man das Gen hinzufügen. Es handelt sich mehr um archetypische Konzepte, die in der Wissenschaft verankert bleiben und von Forschern trotz massiver Bedeutungsverschiebungen im Lauf der Geschichte durchgängig akzeptiert und verwendet werden, weil ihnen innere Urbilder entsprechen (an die wir von Herzen glauben können). Diesen archetypischen Hintergrund gilt es zu identifizieren, wenn man das Weltbild verstehen will, das die Wissenschaft entwirft.
Man versteht sicher nicht, was ein Atom ist, wenn man sich ein Bild im Sinne von »picture« macht – also ein Bild, wie es in diesem Jahrhundert noch das Bohrsche Atommodell von 1912⁄13 vorgezeigt hat. Und man versteht nicht, was ein Gen ist, wenn man sich ein ähnlich geartetes Bild macht – etwa ein Stück DNA in seiner doppelt schraubenförmigen Struktur mit einer festen Länge. Atome wie Gene werden nicht durch noch so schöne »pictures«, sondern nur als »images« verstehbar, und dabei verschwindet ihre schlichte Anschaulichkeit. Atome sind längst keine Dinge mehr, die man durch einen festen Ort im Raum charakterisieren oder im Kontinuum der quantenmechanischen Wahrscheinlichkeiten identifizieren könnte. Und Gene sind längst keine Gebilde mehr, die man durch einen festen Ort in der Zelle charakterisieren und im Kontinuum der biologischen Evolution identifizieren könnte. Trotzdem gibt es Bilder (images) von Atomen und Genen, und wir benötigen sie auch, da – wie von Augustinus zu lernen war – alle Ausdrücke erst dann ihre kommunikative Bedeutung bekommen, wenn sie sich auf innere Bilder beziehen lassen.
Daß in solch einer Situation die Mitwirkung der Kunst gefragt ist, hat zuerst Niels Bohr ausgedrückt: »Die Quantentheorie ist ein wunderbares Beispiel dafür, daß man einen Sachverhalt in völliger Klarheit verstanden haben kann und gleichzeitig doch weiß, daß man nur in Bildern und Gleichnissen von ihm reden kann.«
XIV. Gestaltung von Wissenschaft
Im Mittelpunkt der Wissenschaft, im Zentrum des dazugehörigen Erkennens und in den Anfängen des entsprechenden Denkens treffen wir also auf Bilder. Sie haben zwar keinen rationalen Ursprung, lassen sich aber durch Begriffe (wie Atom oder Gen) ausdrücken, die im rationalen Diskurs kommunikabel sind. Wenn »Wissenschaft machen« heißt, daß Forscher diese Bilder finden und vorstellen können, dann muß »Wissenschaft verständlich machen« heißen, der Öffentlichkeit zu helfen, diese Bilder ebenfalls finden und sich vorstellen zu können. Der Weg dazu liegt nicht im bloßen Informieren über Wissenschaft, sondern in der Gestaltung dieses Tuns. Wissenschaft muß eine Form bekommen, die wahrnehmbar und damit erlebbar wird. Damit könnte ein »public understanding of science« gelingen, und »Wissenschaftsgestaltung« ist vielleicht die geeignete Übertragung der englischen Worte in die deutsche Sprache. Die Öffentlichkeit wird Wissenschaft verstehen, wenn die Ergebnisse und Inhalte der Forschung so vorgelegt werden, das sie die wahrnehmbare Gestaltung bekommt, die Thomas Mann in Chicago so bewundert hat. Dann wären wir alle »unermüdet von diesem Schauen«, und wir könnten der Wissenschaft den Stellenwert einräumen, den die Kunst schon hat.
Wie erreicht man dieses Ziel, das für die Wissenschaft eine Form der Kennerschaft mit sich bringt? Hier wird die Ansicht vertreten, daß die Antwort in der Verbindung zur Kunst steckt. Mit ihrer Hilfe kann die Wissenschaft eine Form bekommen, mit der die Wahrnehmung und die Erlebnisfähigkeit der Menschen angesprochen wird. Die Wirkung poetischer Bilder zu nutzen wäre die Aufgabe der Menschen, die sich vorgenommen haben, für ein »public understanding of science« zu arbeiten. Es reicht doch schon lange nicht mehr, nur die Ergebnisse wissenschaftlicher Publikationen aus Fachblättern abzuschreiben und umzuformulieren und dieses Vorgehen als Wissenschaftsvermittlung zu deklarieren. Da meint man zum Beispiel, die raffinierte Qualität der Proteine vermitteln zu können, indem man den nichtssagenden Ausdruck »Eiweiß« für sie benutzt. Dabei ist es – in erster Näherung – völlig nebensächlich, wie ein Protein funktioniert (was man nebenbei noch weniger begreift, wenn man von Eiweißen redet). Worauf es zunächst ankommt, ist den Menschen zu zeigen, wo die Wissenschaft als denkende Macht steht, und zwar in Hinblick auf jeden einzelnen selbst – also auf mich –, und welchen Platz im Weltbild der Wissenschaft er einnimmt. Wissenschaftsvermittlung – zum Beispiel in Form von Wissenschaftsjournalismus – muß versuchen, ein Abschreiben auf höherer Ebene zu sein,[16] also eine Darstellung wissenschaftlich gewonnener Einsichten in einer Form, die der Öffentlichkeit das Erleben erlaubt, von dem Alexander von Humboldt gesprochen hat. Wissenschaftliche Ergebnisse müssen gestaltet werden, um eine wahrnehmbare Form zu bekommen, die Menschen keine Begriffsakrobatik abverlangt, sondern sie vielmehr innerlich betrifft. Sie müssen sich so dem Auge darbieten, wie es die Natur selbst tut. Nur solch eine Wissenschaftsgestaltung kann den Dreiklang aus Wissenschaft, Kunst und Humanität wieder hörbar machen, den Alexander von Humboldt in seiner (romantisch geprägten) Zeit ertönen lassen wollte und von dem er sich bereits im frühen 19. Jahrhundert das erhoffte, was heute »public understanding of science« heißt.
Ausgabe Nr. 22, Frühjahr 2023