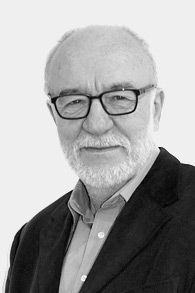Bevor das mit Wissenschaftsgestaltung bezeichnete Programm akzeptiert und in Angriff genommen werden kann, müßten Wissenschaftler besser über die Vorgehensweise der Kunst und die Verbindung zu ihr informiert sein. An dieser Stelle herrscht bislang eine auffällige Asymmetrie. Wissenschaftler nicken nämlich rasch und einvernehmlich, wenn sie hören, daß Fortschritte aus ihrem Bereich Wirkungen in der Kunst nach sich gezogen haben. Sie denken dabei etwa an die physikalische Theorie der Farben, die sich auf die impressionistische Malerei auswirkte, oder sie weisen auf die Entwicklung von Tubenfarben hin, die es den Künstlern erlaubte, ihr Atelier zu verlassen und mit ihren Leinwände in die Landschaft zu gehen. Und im Detail können sie sogar bestaunen, welche dramatischen Spiralen Vincent van Gogh an seinen »Sternenhimmel« malte, nachdem er erfahren hatte, daß die Astronomen seiner Zeit in dieser Form die Gestalt von Galaxien erkannt hatten.
Wissenschaftler reagieren aber eher ungläubig, wenn man ihnen sagt, daß es auch umgekehrt geht, daß die Kunst die Wissenschaft voranbringen kann – durch eine neue Ästhetik. Dabei geschieht dies ganz offenkundig, zum Beispiel im Rahmen des Vorgangs, durch den Bilder etwa auf Computerbildschirmen in abgetrennte Flächen aus Farbe (Pixel) zerlegt werden. Dieses Verfahren ist uns von pointillistischen Malern wie Seurat vorgeführt und somit erfunden worden. Und die Technik der Falschfarben, mit deren Hilfe Wissenschaftler unauffällige Elemente in ihren Daten betonen, stammt von den Malern, die dort in Museen hängen, wo die wilden Fauvisten ausgestellt werden.
Einige Beispiele für die Hilfestellung, die Wissenschaft durch Kunst erfährt, sind kürzlich in dem britischen Wissenschaftsmagazin Nature zusammengestellt worden, das seit längerem eine Kolumne eingerichtet hat, die zwar »Science in culture« heißt, die aber nicht nur darstellt, welche Spuren die Wissenschaft in der Kultur hinterlassen hat, sondern die auch in die Gegenrichtung schaut:[17]
»Künstler erfinden oft neue Strukturen, die Wissenschaftler anschließend in der Natur finden. Virologen, die in den 50er Jahren versucht haben, die Struktur der Proteinhüllen zu verstehen, die kugelförmige Viren wie den Polio Virus umgaben, wurden geleitete durch die geodätischen Strukturen, die Richard Buckminster Fuller entworfen hatte. Sie dienten auch als Modelle für zahlreiche Kohlenstoffmoleküle, die mit dem passenden Ausdruck Fullerene benannt wurden und zu denen der perfekte geodätische Dom eines C60-Moleküls gehört – einem Buckminsterfulleren«.
Mit anderen Worten: Die Entwürfe der Kunst können eine Schule des Sehens für die Naturwissenschaften werden, die doch mit immer neuen Techniken versuchen, das Unsichtbare sichtbar zu machen, ohne dabei zu verstehen, daß sie das mit technischen Hilfsmitteln dargebotene Material sowohl auf biologische vorgegebene als auch durch kulturell eingeübte Weise betrachten. Man sieht auch in der Wissenschaft nur, was man weiß. Was für das Erkunden von äußeren Bereichen gilt, trifft auch für die Reisen in innere Räume zu. Oder mit anderen Worten und umfassender ausgedrückt: Wir sollten den Gedanken ernst nehmen, daß die Kunst eine notwendige Bedingung zur Herstellung des neuen Bewußtseins sein kann, von dem die zukünftige Wissenschaft ihre Bilder – und damit sowohl ihre Einsichts- als auch ihre Kommunikationsfähigkeit – bezieht.
Doch die Kunst macht der Wissenschaft nicht nur neue Formen zugänglich. Sie liefert auch technische Hilfsmittel, wie sich am Beispiel der Anamorphose zeigen läßt. Mit diesen Ausdruck meint man einen »Gestaltwandel«, und die dazugehörende Vorgehensweise leitet sich aus der Einführung der Perspektive zur Zeit der Renaissance ab. Es geht dabei konkret um die Frage, wie ein raumerfüllendes dreidimensionales Objektes auf eine flache Oberfläche abgebildet werden kann. Bereits vor rund 500 Jahren entdeckten Künstler die entsprechenden Regeln der Transformationen, die in der Naturwissenschaft schließlich zu Beginn des 20. Jahrhunderts angewendet wurden, und zwar zum Beispiel bei D’Arcy Thompson, der sie in seinem Buch On Growth and Form nutze, und bei Julian Huxley, als er Problems of Relativ Growth in seinem gleichnamigen Text untersuchte. In beiden Werken geht es um evolutionäre und embryologische Prozesse, die sich als anamorphe Verzerrungen darstellen lassen, wobei anzumerken ist, daß die moderne (molekulare) Biologie bedauerlicherweise zu diesem Thema nur wenig zu sagen hat. Der Gestaltwandel (Morphogenese) der Organismen bleibt als anschauliche Aufgabe vor unseren Augen stehen.
Während man bei Gestaltbildung und Morphogenese fast erwartet, daß künstlerische Vorgaben der Wissenschaft helfen, scheint dies eher unwahrscheinlich, wenn es um die Verdinglichung von Logik in modernen Computer Chips geht. Doch wer tiefer gräbt, findet auch hier eine Verbindung. Die Chips werden nämlich mit Hilfe von Methoden hergestellt, die aus dem Gewebefilmdruck von Seide und von Radierungen übernommen und angepaßt worden sind. Logische Operationen können – so gesehen – in elektronischen Apparaten durchgeführt werden, weil es bereits die Kunst gab, sie in physikalische Muster zu übertragen, und diese Muster existierten wahrscheinlich vor allem deshalb, weil ihre Designer besser als rationale Wissenschaftler verstehen, wie man logische Operationen in Bilder verwandelt.
Wenn vom Verhältnis von Wissenschaft und Kunst die Rede ist, kann es nicht lange dauern, bis das Stichwort Renaissance fällt. In dieser Epoche gehörten Wissenschaft und Kunst so eng zusammen, daß sie mit hoher Qualität von einer Person ausgeübt werden konnten. Vor allem in Leonardo da Vinci vereinigen sich wissenschaftliche Analyse und poetische Intuition und bringen eine Weltsicht hervor, die als »morphologisch« bezeichnet worden ist.[18] Ihm gelang es, in Bildern die Bewegung des Denkens zu erfassen. Die Malerei liefert auf diese Weise nicht nur ein Modell der Wissenschaft, sie stellt auch die Chance für ihre Gestaltung dar. Wenn Malerei – wie Leonardo sie betreibt – die dauernde Bewegung auf ein Urbild hin ist, dann wird in der entstandenen und gestalteten Form auch deren Bildung – die Formwerdung also – deutlich. Und damit wird die Bewegung des Denkens sichtbar, die zur Wissenschaft gehört. Wenn wir ihr folgen, kommen wir zu den Welt- und Menschenbildern, die wir zur Orientierung brauchen.
Ausgabe Nr. 22, Frühjahr 2023