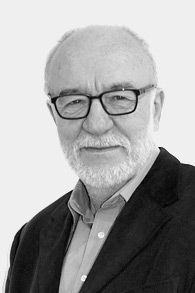Kepler spielt auch eine Rolle in die andere Blickrichtung, bei der Fernrohre konstruiert und an den Himmel gerichtet werden. Zu dieser Entwicklung trägt ein Italiener – Galileo Galilei – ebenso bei wie etwas später ein weiterer Engländer – Isaac Newton. Zwar hat sich dessen eigenwilliger Gegenspieler Johann Wolfgang von Goethe einmal darüber beklagt, daß »Mikroskope und Fernröhre eigentlich den reinen Menschensinn verwirren«, doch dieser Einwand trägt nicht weit. Denn der Mensch, der die genannten Geräte benutzt, hat dabei längst einen angefüllten und mit vielen künstlerischen und wissenschaftlichen Ideen und Bildern besetzen Sinn, ohne den er trotz allen Blickens nicht viel sehen würde. Wenn Goethe geschrieben hätte, »Fernrohre helfen dem geschulten Menschensinn«, wäre er den historischen Tatsachen nähergekommen, wie sich am Beispiel von Galileo Galilei erweist, der im frühen 17. Jahrhundert etwa zur gleichen Zeit wie der Engländer Thomas Harriot sein wahrscheinlich ähnlich gutes (bzw. aus heutiger Sicht ähnlich unzureichendes) Fernrohr auf den Mond richtete.[2] Beide Beobachter bemerkten dabei gezackte Linien, die den kleinen Himmelskörper von oben nach unten durchzogen. Während Harriot aber nur deren Muster erblickte, ohne einen Schluß daraus ziehen zu können, sah der als Landschaftsmaler in der Naturbeobachtung geschulte Galilei weiter, und er erkannte in den scharfen Trennlinien von Hell und Dunkel das typische Muster von Schatten, die Bergrücken werfen, wenn die Sonne flach einstrahlt. Mit anderen Worten, währen Harriot nur Linien sah (und nichts bemerkte), sah (und also entdeckte) Galilei Berge auf dem Mond. Und von diesem Augenblick (!) an darf man sich den Trabanten nicht mehr mit glatter Oberfläche vorstellen.
IV. Visualisierte Wissenschaft
Die instrumentelle Verbesserung des visuellen Zugangs zum vielfach unsichtbaren Wirklichen konnte vor allem im 20. Jahrhundert weit vorangetrieben werden, und den Menschen der modernen Zeit stehen inzwischen neben vielfältigen Verfahren wie Färbetechniken, Phasenkontrast, Autoradiographie, Hochgeschwindigkeitsphotographie, Enzephalographie, Sonographie, Computersimulationen und Röntgenbeugung noch imponierende Instrumente wie Hochleistungsteleskope, Satellitenkameras, Raster- und Tunnel-Elektronenmikroskope, Teilchenbeschleuniger und Computertomographen zur Verfügung, wobei die dabei erzielten Aufnahmen inzwischen digitalisiert und derart freizügig mit sogenannten Falschfarben verziert oder »verbessert« werden, daß sich der Eindruck einstellt, hier wird mehr der Schönheits- und weniger der Spürsinn des forschenden Betrachters angesprochen.[3]
Es läßt sich leicht vorhersagen, daß die Rolle der Bilder in der Forschung in naher Zukunft zunehmen wird. Die ersten amerikanischen Universitäten haben bereits ihr »Center for Imaging Science« eingerichtet, also etwa »Zentrum für bildgebende Wissenschaft«. Und an der Humboldt-Universität untersuchen Kunst- und Kulturwissenschaftler(innen) die Rolle, die »Das technische Bild« sowohl in der historischen Entwicklung als auch in der aktuellen Bewertung der Forschung spielt. Unter solchen Vorgaben kann zum Beispiel das Bild als Werkzeug der Wissenschaft erkundet oder die Triumphe und die Fallen der Computervisualistik diskutiert werden. Daß es Gefahren auf diesem Sektor gibt und daß die vielfach schon als visuelle Wende der Wissenschaft gefeierte Durchdringung des Forscheralltags mit Bildern durchaus nicht ohne Probleme abläuft und nie ohne besondere Kontrolle vor sich gehen darf, hat bereits vor rund 100 Jahren Robert Koch bemerkt, der selbst viele Färbemethoden in die Mikroskopie eingeführt und zur Identifizierung von pathogenen Mikroorganismen genutzt hat. Vor diese Erfolge hatte die Natur allerdings den Schweiß der Identifizierung vieler Artefakte gesetzt, und Koch mußte höchstpersönlich erfahren, wie leicht es passieren kann, daß sich in den mikroskopischen Präparaten »mehr fotografieren ließe, als in der Wirklichkeit vorhanden ist.« Hinter dieser nur durch methodische Sorgfalt zu begegnenden Gefahr lauert eine zweite, die mit dem menschlichen Vergnügen am Betrachten von Bildern zusammenhängt und sich in Kochs Worten so ausdrücken läßt: »Das fotografische Bild eines Gegenstandes ist unter Umständen wichtiger als dieser selbst.«[4]
Unabhängig davon können geeignete Bilder ein auf Verständnis basierendes Vertrauen für die Wissenschaft schaffen, sie können sie wieder zu einem Gegenstand der Kontemplation machen und vielleicht sogar die notwendige öffentliche Nähe zu ihr herstellen und sinnliche Leidenschaften wecken, wie die eingangs erzählte Begebenheit verdeutlicht. Sie zeigt in persönlich faßbarer Deutlichkeit, wie Thomas Mann mit der ästhetischen Hilfe der dem Auge gefallenden Modelle und Bilder ein Verständnis der Evolution und ein Gefühl für den Zusammenhang der lebendigen Formen nicht nur bekommt, sondern darüber hinaus auch erlebt. Bei der Wahrnehmung der Museumsstücke sieht und erfaßt er etwas von sich und seinem Menschsein, und zwar über seine anschaulich werdende Zugehörigkeit zum Ganzen der Natur. Er erblickt, was zwar konkret unsichtbar bleibt, was aber ebenso offensichtlich in ihm angelegt ist. Und bei vielen Bildern wird man ebenfalls etwas sehen, das gewöhnlich unsichtbar ist, das aber – wortwörtlich – der Natur nach zum Menschen gehört und das an uns Sichtbare hervorbringt.
V. Die Bedeutung des Ästhetischen
Wenn hier von »ästhetischen Qualitäten der Forschung« gesprochen wird, dann ist damit der ursprüngliche Begriff des Ästhetischen gemeint, der nichts mit der Einschätzung oder Bewertung von Kunstwerken zu tun hat, so wie es heute zumeist verstanden wird. Diese spezielle Ästhetik ist nur die fein verzweigte Spitze eines Astes, der sich von einem Baum entfernt und abzulösen beginnt, dessen Stamm mehr Möglichkeiten bietet. Ästhetik bezeichnet nämlich ihrer ursprünglichen Bedeutung nach das, was auch die Wissenschaft europäischer Herkunft sein wollte, nämlich ein eigenständiges Verfahren zum Finden und Erkunden des Wirklichen. Genauer gesagt geht es in der Ästhetik um den Beitrag der Sinne zur Lösung dieser Aufgabe, und da Bilder von Sinnen verstanden werden, ist die Rolle, die sie bei der Erkenntnis der Wirklichkeit spielen, ein Thema der Ästhetik.
- [2] Holton, Gerald: The Art of Scientific Imagination. Daedalus, Spring 1996. S. 183–208.
- [3] Vgl. dazu: Fischer, Ernst Peter: Images & Imagination. Editiones Roche, Basel 2001.
- [4] Siehe dazu: Schlich, Thomas: »Wichtiger als der Gegenstand selbst«: Die Bedeutung des Bildes in der Begründung der bakteriologischen Krankheitsauffassung durch Robert Koch. In: Dinges, Martin; Schlich, Thomas (Hg.): Neue Wege in der Seuchengeschichte. Robert-Bosch-Institut für Geschichte der Medizin, Stuttgart 1995.
Ausgabe Nr. 22, Frühjahr 2023