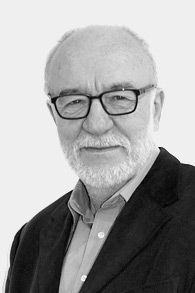Die erwähnte Bestimmung läßt sich an der griechischen Wurzel ablesen, deren Bedeutung bei Aristoteles nachzulesen ist. Zu Beginn seiner berühmten Schrift »Metaphysik« charakterisiert der griechische Begründer aller westlichen Wissenschaft die ihm bekannten europäisch-abendländischen Menschen durch die Bemerkung, daß sie von Natur aus nach Wissen streben. Als Begründung für seine Feststellung weist Aristoteles auf die Freude hin, die Menschen an ihren Sinneseindrücken bzw. ihren sinnlichen Wahrnehmungen haben. Der erste Satz der »Metaphysik« (mit der Nummer 980a) lautet vollständig in einer modernen Übersetzung: »Alle Menschen streben von Natur her nach Wissen; dies beweist die Freude, die sie an den Sinneswahrnehmungen haben, denn diese erfreuen an sich, auch abgesehen von dem Nutzen, und vor allem anderen erfreuen die Wahrnehmungen mittels der Augen.«[5]
Im Griechischen steht aisthesis für das deutsche »Sinneswahrnehmungen«, und aus diesem Wort hat sich die Bezeichnung »Ästhetik« für ein erkenntnistheoretisches Konzept entwickelt, das den Beitrag der Sinne bei der Erkenntnis mit berücksichtigen und ihn dem logisch-rational vorgehenden und vornehmlich begrifflich ausgerichteten Erfassen der Wirklichkeit an die Seite bzw. komplementär gegenüberstellen wollte. Das Besondere an der Wahrnehmung – auch von Bildern – besteht darin, daß sie immer nach einer durchgängig gestalteten Form sucht und sich nicht um Details kümmert. Wahrnehmung geht – mit banalen Worten formuliert – aufs Ganze, das sie unmittelbar erfaßt und dem sie Struktur gibt – und zwar vor jeder Einbeziehung eines Begriffs und auch noch bevor die Aufmerksamkeit auf benennbare Einzelheiten in der Absicht gelenkt wird, sie anschließend zu beobachten und zu quantifizieren. So nimmt man zum Beispiel an einem Menschen, dem man gegenübertritt, erst einen umfassenden Zug seiner Persönlichkeit wahr – zum Beispiel seine Neugierde, seine Vertrauenswürdigkeit oder seine Eleganz –, bevor man einzeln quantifizierbare Eigenschaften – die Farbe und Länge der Haare etwa oder die Dimensionen der Hände und Finger – beobachtet und registriert. Gerade auch beim Betrachten von Bildern fängt der erkennende Vorgang mit einer Wahrnehmung der gesamten Form an, bevor Details ins Visier und zur Kenntnis genommen werden.[6]
Dem skizzierten ursprünglichen Gedanken einer für die Naturwissenschaft relevanten Ästhetik, der zum ersten Mal im 18. Jahrhundert von dem Philosophen Alexander Gottlieb Baumgarten in seiner zweibändigen »Aesthetica« vorgeschlagen und ausgearbeitet worden ist, liegt die feste Überzeugung zugrunde, daß es viele sinnlich zugängliche Bereiche der Welt gibt – zum Beispiel individuelle Menschen mit ihrem einzigartigen Schicksal oder aktuelle Zufälligkeiten –, die sich weder durch eine experimentelle Messung noch im Rahmen einer mathematischen Analyse erfassen lassen – und zwar untere anderem deshalb, weil sie nur als Ganzes relevant sind. Die mit Hilfe dieser zuletzt genannten Vorgehensweisen ermöglichte »theoretische« Erkenntnis bleibt also immer unvollständig, was keinesfalls als Unglück verstanden, wohl aber als unvermeidliches Faktum zur Kenntnis genommen werden sollte.
Die theoretische Erkenntnis verzichtet auf das Werkzeug für die Wahrheit, das Goethe einmal als »exakte sinnliche Phantasie« bezeichnet hat und von dem er – wohl zu recht – behauptet hat, daß sich ein rechter wissenschaftlicher Verstand schwer damit tut. Der mit Hilfe dieser Fähigkeit verfolgte rationale Ansatz kann durch eine dem Menschen von Natur aus gegebene »ästhetische« Komponente ergänzt werden, die mehr das Individuelle, das Unverwechselbare, das Kontingente und das Qualitative (das Schöne) und weniger das Allgemeine, das Austauschbare, das Gesetzmäßige und das Quantitative (das Meßbare) im Auge hat. Leider hat es unsere westliche Wissenschaftskultur im Verlauf ihrer Entwicklung erst verlernt und zuletzt aufgegeben, die primären Eindrücke der Sinne – das Besondere von Formen und Farben – intakt zu lassen. Sie ignoriert damit ihren eigenen Ursprung und vergißt, daß wir europäischen Menschen – der zitierten Einsicht des Aristoteles zufolge – primär wahrnehmende und damit ästhetische Wesen sind. Daß sich die abendländische Kultur im Rahmen der modernen Wissenschaft – wie es der Biologe Adolf Portmann einmal ausgedrückt hat – von dem sinnlich Vertrauten entfernt und statt dessen mehr darum bemüht hat, »diese Qualitäten zu überwinden und durch meßbare Größen zu ersetzen«, mag historisch verständlich und rational nachvollziehbar sein, läßt aber zugleich zumindest Teile der Wissenschaft »lebensfremd« erscheinen und den Wunsch nach einer »menschennäheren« Form ihre Praxis aufkommen.[7]
Die Idee der Meßbarkeit bzw. Quantifizierung aller Qualitäten hat einen derzeit aktuellen Höhepunkt im Konzept der Information erreicht, mit dessen Hilfe die obengenannte Teilung des Wissens in zwei komplementäre Bereiche sich einprägsam verdeutlichen läßt. Man braucht sich dazu nur klarzumachen, daß es zwei verschiedene Arten von Fragen gibt. Auf der einen Seite stehen die Fragen, die sich durch Informationen beantworten lassen – etwa die, wieviel Autoren in diesem Buch versammelt sind und welchen Disziplinen sie angehören. Auf der anderen Seite stehen die Fragen, die sich dadurch auszeichnen, daß ihre Klärung gerade nicht durch irgendeine Information erfolgen kann, zum Beispiel die, warum Thomas Mann oder andere Menschen rauschartige Gefühle beim Anblick früher Menschenformen bekommen und überhaupt Gefallen an Bildern finden und fröhlich werden, wenn sie darin ein Stück von sich selbst finden können.
- [5] Zitiert nach Seite 37 der Ausgabe der Rowohlt Enzyklopädie, Rowohlt Taschenbuch, Reinbeck 1996, übersetzt von Hermann Bonitz.
- [6] Vgl. zum Beispiel: Fischer, Ernst Peter: Das Schöne und das Biest. Piper Verlag, München 1997.
- [7] Vgl. dazu Portmann, Adolf: Biologie und Geist. Burgdorf Verlag, Göttingen 2000.
Ausgabe Nr. 22, Frühjahr 2023