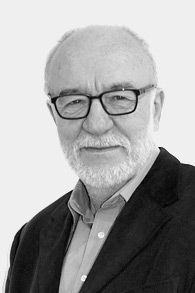VII. Ein großer Gedanke
Das ästhetische Wissen, das die Wahrnehmung den Menschen verschafft, hat schon Aristoteles als das Wissen des Besonderen bezeichnet, und nur dieses Wissen ist es, das die Wirklichkeit relevant erfaßt. Das Allgemeine ist unwirklich, und es bringt keine moralische Verhaltensweise hervor. Es läßt einen kalt. Von dem, was eine ausschließlich mit Hilfe der theoretischen Funktion betriebenen Wissenschaft kennt, führt tatsächlich kein Weg vom Sein zum Sollen. Bei dem Besonderen sieht dies anders aus, und wenn es zudem gelingt, seine Schönheit wahrzunehmen, besteht die große Chance zu wissen, was man tun soll. Das wahrgenommene Sein führt im empfindsamen Menschen zum Sollen. Es ist deshalb die Wahrnehmung, aus der die Ethik der Wissenschaft sich entwickeln kann, denn die sinnliche Erfahrung ist offenbar in der Lage, das Wertewissen zu vermitteln, das zu einer moralischen Haltung führt. Die Praxis der Wissenschaft kann nur dann das Attribut »ethisch« verdienen, wenn sie aufhört, wertfrei sein zu wollen und erkennt, daß ihre Tätigkeit Werte hervorbringt und also wertvoll ist.
Der Begriff der »wertfreien Wissenschaft« ist bekanntlich in Folge des philosophischen Denkens entstanden, das als Rationalismus bezeichnet wird. Im Rahmen seiner Bemühungen wurde behauptet, daß die Wissenschaft sich nicht bei der Frage aufzuhalten habe, ob die Gegenstände ihrer Begierde und die Ergebnisse ihrer Aneignung ethisch wertwidrig oder angemessen sind, ob sie Heil oder Unheil in sich tragen, ob sie der Bewahrung oder der Zerstörung dienen (können). Wichtig sei einzig der wissenschaftlich genaue Umgang mit den Dingen und der Versuch, dabei etwas Nützliches, zum Beispiel in technischer Hinsicht, zu bewirken. Die meisten Forscher haben solche Vorgaben zwar schnell und gerne aufgegriffen, um sich frei ihren Gegenstand auswählen und an ihm praktische Verfahren wertfrei probieren und entwickeln zu können, aber heute spüren sie, daß dies unzureichend ist und eine neue Betrachtung nötig wird.
Sie kann mit Hilfe der Kunst gelingen, wie in einem anderen Zusammenhang einmal von einem amerikanischen Autor bemerkt worden ist. In den »Notizbüchern« von Raymond Chandler, dem Erfinder des legendären Philip Marlowe, findet sich unter dem Datum vom 19. Februar 1938 ein Eintrag unter der besonderen Aufmerksamkeit verlangenden Überschrift »Großer Gedanke« (»Great Thought«). Da heißt es:
»Es gibt zwei Arten von Wahrheit: Die Wahrheit, die den Weg weist, und die Wahrheit, die das Herz wärmt. Die erste Wahrheit ist die Wissenschaft, und die zweite ist die Kunst. Keine ist unabhängig von der anderen oder wichtiger als die andere. Ohne Kunst wäre die Wissenschaft so nutzlos wie eine feine Pinzette in der Hand eines Klempners. Ohne Wissenschaft wäre die Kunst ein wüstes Durcheinander aus Folklore und emotionaler Scharlatanerie (emotional quackery). Die Wahrheit der Kunst verhindert, daß die Wissenschaft unmenschlich wird, und die Wahrheit der Wissenschaft verhindert, daß die Kunst sich lächerlich macht.«[10]
Der Eintrag wirkt eher isoliert. Der »große Gedanke« muß Chandler plötzlich ergriffen haben. Er kam vielleicht als Inspiration zu ihm, und er könnte eine Inspiration für die Zukunft sein. Es müßte gelingen, die beiden Bemühungen der Menschen um Wahrheit zusammenzubringen, um eine neue ästhetisch orientierte Wissenschaft zu gründen. Ästhetik ohne Wissenschaft bleibt nutzlos, und Wissenschaft ohne Ästhetik bleibt wertlos. Wissenschaft mit Ästhetik kann wertvoll werden. Was zur Wissenschaft gehört und ihr bislang fehlt, ist der Blick der Kunst, wenn Kunst als Interpretin der Natur auftritt. Was dem Forscher fehlt, ist die Wahrnehmung des Künstlers, der die Natur studiert, um das Erlebte in neuer Form darzustellen.
Es muß vermehrt zu einem Wechselspiel zwischen den Künsten und den Wissenschaften kommen, allein deshalb, weil die Wahrheit der Wissenschaft längst so unmenschlich geworden ist, wie Raymond Chandler es befürchtet hat. Zumindest haben die ethischen Probleme des Forschens und die moralische Fragwürdigkeit so stark zugenommen, daß zwischenzeitlich schon höhere Mächte aufgefordert worden sind, uns zu retten – etwa bei Martin Heidegger und bei Hans Jonas. Doch so hoch braucht niemand zu greifen, und es reicht, vor dem Naturschönen ergriffen zu sein. Dieses Innewerden könne die Menschen zuletzt moralisch werden lassen, wie es Josef Brodsky einmal vermutet hat. In einem seiner Essays von 1996 heißt es:
»Jede neue ästhetische Realität präzisiert die ethische. Denn die Ästhetik ist die Mutter der Ethik. Die Begriffe ›Schön‹ und ›Nicht-Schön‹ sind zunächst ästhetische Begriffe, welche den Kategorien ›Gut‹ und ›Böse‹ vorausgehen. In der Ethik ist gerade deshalb nicht ›alles erlaubt‹, weil in der Ästhetik nicht ›alles erlaubt‹ ist, zum Beispiel, weil die Farbskala des Spektrums begrenzt ist.«
Am Anfang des wahrnehmenden und sinnlichen Lebens steht nach Brodsky eine ästhetische Wahl, und bei dieser Wahl richten sich Menschen nach der Schönheit, die sie erfassen. Es ist nun diese auf andere Menschen gerichtete Wahrnehmung, aus der moralische Vorstellungen fließen, und es ist diese Wahrnehmung des Schönen, die sinnliche Erkenntnis der Wirklichkeit, auf die es sich zu besinnen gilt. Denn, so schreibt Brodsky: »Je reicher die ästhetische Erfahrung eines Individuums, desto unbeirrbarer sein Geschmack, desto präziser sein moralisches Urteil, desto größer seine Unabhängigkeit.«[11]
Ausgabe Nr. 22, Frühjahr 2023