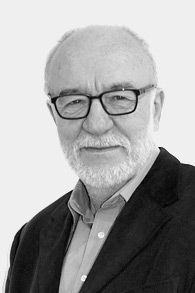VIII. Der Wert des Embryos
Erforschte und andere Dinge bekommen ihren Eigenwert nicht durch rationale Begriffe, sondern durch ästhetische Bemühungen. Die künftige Wissenschaft bekommt erst dann eine allgemein zugängliche und verständliche ethische Dimension, wenn sie versucht, die Natur weniger mit Begriffen und mehr mit den Sinnen zu erfassen, und zwar so, daß sich dabei ihre Schönheit zeigt. Leider versucht man im Rahmen der heute aktiven Umweltschutzbewegung zum Beispiel (noch) nicht, die Natur zu bewahren, weil sie schön ist, sondern weil sie beschädigt und also häßlich geworden ist. Ein überzeugender Umgang mit der Umwelt muß und kann aus ästhetischen Quellen kommen. Das Bewahrenswerte muß durch seine Schönheit wahrgenommen werden, die sich über die Sinne erschließt.
Ein in diesem Sinne ästhetisch orientierte Wissenschaft, in der das Wahrnehmen von Bildern und damit die sinnliche Form des Erkennens der logisch-verstandesgemäßen Form gleichberechtigt an die Seite gestellt wird, könnte auch einen Beitrag zu der seinerzeit (im Sommer 2001) hohe Wellen schlagenden und selbst das Parlament aufwühlende Debatte über Stammzellen, Embryonen und eine neue Form der medizinischen Diagnostik liefern, die unter dem Stichwort Präimplantationsdiagnostik (PID) geführt wird. Das zuletzt genannte Verfahren wendet sich künstlich befruchteten Eizellen zu, die zuerst in einer Schale im Laboratorium heranwachsen und anschließend einer Frau eingesetzt (implantiert) werden sollen, in der dann zuletzt – wenn alles gut geht – ein Kind heranwächst. Das umfassende Verfahren der »In-vitro-Fertilisation« (IVF) wurde entwickelt für Paare, die sich ihren Kinderwunsch nicht auf dem üblichen Weg erfüllen können, und die PID liefert zusätzlich die Möglichkeit, unter den befruchteten und sich teilenden Eizellen diejenigen auszuwählen, die am wenigstens genetisch belastet sind (wenn man es neutral ausdrückt) und die größte Hoffnung auf ein gesundes Kind bietet. In dem geschilderten Ablauf lassen sich viele ethische Schranken entdecken, die auf derzeit täglich vielen Zeitungsseiten geschlossen oder geöffnet werden. Dabei geht es vor allem und wiederholt um die Menschenwürde des Zellgebildes, das da in einer Schale heranwächst und ein Mensch werden kann (oder will?). Von welchem Zeitpunkt an – so die vielfach gestellte Frage – handelt es sich bei den sich teilenden Zellen um menschliches Leben, das dann – wenigstens zum Teil – seine besondere Würde hat und somit auch unter dem Schutz des Staates steht? Ist ein Embryo schon ein Mensch oder eher noch ein Zellhaufen?
Trotz all des Geschriebenen zum Thema mit nahezu unendlich vielen Worten und Begriffen ist eine Einigung unter den streitenden Parteien – Politiker, Ethiker, Biologen, Christen, Gewerkschaftler, Unternehmer und viele mehr – nicht einmal in Ansätzen in Sicht, wobei ein Historiker anmerken könnte, daß die Debatte nicht neu ist und im Prinzip bereits mit Platon und Aristoteles begonnen hat, bei denen es schon um die Frage ging, was mehr zählt, der Wert eines Individuums oder der Wert einer Gemeinschaft. Niemand braucht sich darüber zu wundern, daß die alten Gegensätze der Bewertung nicht plötzlich durch ein neues Argument mit Begriffen verschwinden. Die Gegensätze werden vielmehr solange bestehen bleiben, solange man nur mit Worten trefflich streitet und das ästhetische Element keine angemessene Beachtung findet und mitspielen darf. Wie soll denn aus Worten das geeignete Handeln fließen? Wir werden doch nur dann zu moralisch handelnden Wesen, wenn wir ein Gegenüber durch seine individuelle Besonderheit wahrnehmen und erkennen können, wie seit Aristoteles bekannt sein könnte und wie jeder von seinen eigenen Erfahrungen her weiß. Anders ausgedrückt für den konkreten Fall der PID: Ein Zellhaufen ohne jede Struktur (Form) löst in einem Betrachter keine Reaktionen hervor, die moralische Konsequenzen hätten, und zwar selbst dann nicht, wenn er in wissenschaftlich fundierten Worten zu sagen weiß, war er vor sich sieht und hat, nämlich Zellen, die ein humanes Genom beherbergen. Man weiß sich doch erst dann angemessen zu verhalten, wenn etwas über die Worte hinaus wahrgenommen werden kann, wenn sich eine Form zeigt, die in dem Betrachter den werdenden Menschen erkennen läßt und Mitgefühl hervorruft. Diese Disposition läßt sich nicht von außen anordnen. Sie bildet sich eigenständig im Individuum als ästhetische Reaktion. Dabei helfen weder Begriffe noch Institutionen, selbst wenn sie eine besondere Nähe zu Gott für sich in Anspruch nehmen. Eine ethische Entscheidung, die nach ästhetischen Gesichtspunkten getroffen wird, könnte klarer und unstrittiger nicht sein. Sie erschließt sich unmittelbar in der Anschauung (»Sieh hin und du weißt«) und kommt weiter als viele Debatten mit noch mehr komplizierten Begriffen, die sich bekanntlich widersprechen müssen und allein deshalb die meisten Menschen nicht erreichen.
IX. Die kunstmäßige Natur
Wenn (schöne) Bilder zu sehen sind, taucht unwillkürlich die Frage nach der Kunst auf. Die Natur tritt uns auf vielen Bilder fraglos wie ein Kunstwerk oder ein Ornament entgegen, und dies wirft die Frage nach der Zugehörigkeit zur Kunst auf. Sie läßt sich auf keinen Fall mit ein paar Bemerkungen erledigen, außer mit derjenigen, die Kant in seiner »Kritik der Urteilskraft« gemacht hat. Hier heißt es, daß Natur dann schön ist, wenn sie aussieht wie Kunst, und daß auch umgekehrt Kunst dann schön ist, wenn sie aussieht wie Natur.
Ein Kunstwerk benötigt zu seiner Bestimmung natürlich mehr Kriterien als das der Schönheit. Einsichtig ist auf jeden Fall, daß die Natur in den technischen Bildern der Wissenschaft eine Form bekommen kann, die sie »kunstmäßig« macht, wie es Friedrich Schiller in seiner Schrift »Kallias oder über die Schönheit« ausdrückt, um so den zentralen Satz seiner Ästhetik zu formulieren, »Schönheit ist Natur in der Kunstmäßigkeit«.
Ausgabe Nr. 22, Frühjahr 2023