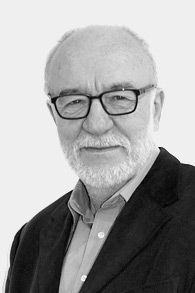Als Schiller am Ende des 18. Jahrhunderts diesen Satz schrieb, hatte der Bedeutungswandel begonnen, der die Ästhetik bald weit von der Natur entfernte und sie ausschließlich für den Bereich der Kunst reklamierte. Seitdem haben wir – vor allem im Gefolge der dialektischen Philosophie Hegels – keinen Blick mehr für das, was Schiller das Naturschöne nannte. Ich vermute hier einen der Gründe dafür, daß die Moderne bestenfalls etwas mit der Schwundstufe dieser Idee, den sogenannten Naturschönheiten, etwas anzufangen weiß und keinen Mut entwickelt, mit wahrgenommenen Bildern nach Erkenntnissen zu suchen.
Wenn von der Schönheit der Bilder gesprochen wird, sollte nicht nur nicht übersehen, sondern von Anfang an festgehalten werden, daß nicht nur das Wort »Schönheit«, sondern auch der so einfach wirkende und so vielfach gebrauchte Ausdruck »Bild« eine Fülle von Möglichkeiten in sich birgt. In diesem Fall wäre es sehr wohl von Vorteil, wenn man sie und sich – gerade in einem wissenschaftlich bereiteten und ausgeschmückten Rahmen – differenzierter ausdrücken würde, als dies im allgemeinen geschieht. Während wahrscheinlich kaum jemandem erklärt zu werden braucht, was schön ist, weil dies doch ohne Begriff klar werden kann, müssen wir beim Bild sagen, für welche Form wir konkret dieses Wort in einem gegebenen Zusammenhang verwenden, denn ein Zeitungsbild (Pressephoto) und ein Weltbild haben zum Beispiel – außer den vier letzten Buchstaben – vermutlich fast nichts gemeinsam. In einer philosophisch gründlichen Diskussion könnte man das Pressephoto als materielles Bild einstufen, das durch die Eigenschaften charakterisiert ist, die Wiedergabe von einem konkreten (»wirklich vorhandenen«) Gegenstand zu sein und mit ihm eine gewisse Ähnlichkeit zu haben. Ein Weltbild hingegen würde man in die Kategorie »ethischer Bildbegriff« einordnen, der bei der Auswahl moralischer Prinzipien hilft und zum Beispiel deskriptive und normative Menschenbilder mit umfaßt.
Das Grimmsche Wörterbuch stellt zu diesem Thema fest, daß unser Wort »Bild« von der althochdeutschen Form »bilidi« abgeleitet ist, in der als Wurzel »billôn« steckt, was wiederum – über einen hier nur angedeuteten lateinischen Umweg – auf »das Gestaltete« hinweist. Bilder sind also ursprünglich etwas Gestaltetes. Sie bezeichnen etwas, das der menschlichen Einbildungskraft entspringt und als innere Substanz des produktiven Künstlers verstanden werden kann, die er im kreativen Prozeß nach außen bringt. »Je größer das Talent, desto entschiedener bildet sich gleich anfangs das zu produzierende Bild«, wie Goethe in dem bereits erwähnten Jahr 1819 geschrieben hat, wobei er offenbar in den Werken von Augustinus gelesen hat, der allgemein Sprache als Denken interpretiert, das sich der Bilder bedient. In seinen »Bekenntnissen« hält Augustinus fest, daß Sprechen notwendigerweise von Bildern begleitet wird. Die beim Reden oder Schreiben verwendeten Ausdrücke erhalten ihre Bedeutung erst in dem Augenblick, in dem sie sich auf innere Bilder beziehen, das heißt auf Bilder, die »aus dem Schatz der Erinnerungen« stammen. Wenn dies nicht der Fall wäre, dann – so drückt es Augustinus aus – »könnte ich überhaupt nichts nennen«.
In der modernen Philosophie spricht man in diesem Zusammenhang vom mentalen Bildbegriff, dem noch weitere an die Seite gestellt werden können – etwa der metaphysische oder der metaphorische –, auf die hier aber nur hingewiesen werden soll, um den Blick einmal über das weite Feld schweifen zu lassen, das sich dem Denken anbietet und auf seine Bearbeitung wartet.
Die Beispiele zeigen, daß die Frage »Was ist ein Bild?« auf keinen Fall mit trivialen Auskünften zu beantworten ist, selbst wenn wir heute massenhaft durch die Medien mit Bildern versorgt und von ihnen umgeben werden und nichts selbstverständlicher als ein Bild zu sein scheint. Doch selbst die kürzeste Aufzählung der vielen Möglichkeiten zeigt, welche Unterscheidungen mindestens beachtet werden können:
Ein Bild kann etwa in Form einer Skizze oder einer Zeichnung vorliegen und der Illustration dienen, oder es kann – zum Beispiel als Gemälde – seinen Eigenwert besitzen und dabei nur für sich stehen. Bilder kann es in der Zeitung, im Fernsehen oder im Kopf geben, und immer meinen wir etwas völlig anderes mit dem einen Wort »Bild«. Wissenschaftshistoriker reden häufig von Weltbildern, die Forscher früher umgestürzt haben – etwa als ihnen der Wechsel von der Klassischen Physik zur Quantenmechanik gelungen ist –, und vor allem die im biomedizinischen Rahmen tätigen Wissenschaftler werden heute vermehrt nach ihrem Menschenbild gefragt, wenn sich die Diskussion um den Fortschritt ihrer Forschung ethischen Themen zuwendet und die Moral ins Spiel bringt.
Ausgabe Nr. 22, Frühjahr 2023