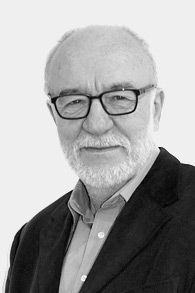X. Das Bild im Kopf
Die eben gegebene Darstellung des Malens kann seltsamerweise sehr direkt auf die natürlichen Vorgänge übertragen werden, die sich in unserem Kopf abspielen, wenn wir den physikalischen Reiz Licht in das physiologische Erlebnis Sehen umwandeln. Dazu muß natürlich erst die Energie der Quanten (Photonen) in biochemische Signale (aktiviertes Rhodopsin und sekundäre Botenstoffe) verwandelt werden, bevor sie danach mit Hilfe der Regulierung von Dunkelströmen Aktionspotentiale in Gang zu setzen, die ihrerseits den Weg in das zentrale Nervensystem finden und dort schließlich in der primären Sehrinde eintreffen. An dieser Stelle befindet sich wahrscheinlich nur ein Zwischenziel der Lichtverarbeitung, und die im Auge empfangene visuelle Information muß noch sehr viel weiter geleitet werden, bevor sie letztlich auf höheren Ebenen bzw. in tiefer gelegenen Schichten des Gehirns ankommt und dort verwendet und in ein bewußtes Bild verwandelt wird. Doch die Forschung kennt sich auf diesen frühen neurophysiologischen Stufen des Sehens am besten aus, und sie hat hier – vor allem dank der Ideen und Experimente von Stephen Kuffler, Torsten Hubel und David Wiesel und ihren Kollegen – herausgefunden, wie Gehirne dabei beginnen, das Bild herzustellen, das sich einem Betrachter präsentiert, der eine Szene vor Augen hat.[13] Das Besondere der wissenschaftlichen Befunde besteht nun darin, daß diese Tätigkeit des zentralen Nervensystems nicht nur ganz einfach formuliert werden kann, sondern unmittelbar an den Bereich des Kunstschaffens anschließt, den wir gerade verlassen haben:
In unserem Kopf wird die sich uns darbietende Szene bzw. das von unseren Augen beobachtete Geschehen, von dem wir ein Lichtsignal empfangen, in all die geometrischen und anschaulichen Einzelheiten zerlegt, auf die etwa ein Zeichner zurückgreifen würde, der eine Skizze anfertigen oder gar ein Bild zeichnen bzw. malen möchte. Das Gehirn trennt das sinnlich Empfangene in Farbe, Form und Bewegung auf, es fächert die Form weiter in Punkte, Linien, Kurven, Ringe, Kreise, Kästen und ähnliches auf, wobei im Detail sogar Orientierungen und Stärke von Balken unterschieden werden. In der primären Sehrinde sieht es so aus wie im Atelier eines Künstlers, auf dessen Arbeitstischen zwischen Farbtöpfen und Linealen alle möglichen Pinsel, Stifte und Kreiden herumliegen. Mit anderen Worten: Was Kuffler, Hubel, Wiesel und viele andere herausgefunden haben und was die Lehrbücher zum Beispiel in visuellen Cortex unter den Stichworten »rezeptives Feld« und »hyperkomplexe Zelle« vorstellen, zeigt, wenn man sich kurz ausdrücken will, daß das Gehirn Bilder malt, wenn es die Welt anschaut und sieht. Unser Kopf malt die Bilder, die wir sehen. Von Photographien und »pictures« ist da nichts zu sehen. Unsere Wahrnehmung der Welt beginnt mit der Herstellung eines »images«. Die Wirklichkeit vor Augen wird zu einem Gemälde im Kopf.
Das heißt, das Malen selbst haben die Neurophysiologen natürlich nicht beobachten können. Sie haben aber entdeckt, daß der Sehapparat die visuelle Szene in Punkte, Winkel und andere elementare Einheiten zerlegt und dabei so vorgeht, als ob er die handwerklichen Vorschriften eines gründlichen Malunterrichts befolgt. Dieses Auseinandernehmen und Sortieren wird einem wahrnehmenden Zuschauer niemals bewußt. Ihm geht es wie einem Besucher im Museum, der nur das fertige Bild zu Gesicht bekommt, und dem sieht man den Prozeß seiner Entstehung nicht mehr an. Wie ein Kunstwerk durch seine Wirkung auf den Betrachter gerechtfertigt wird bzw. seinen Wert gewinnt, muß sich auch das in unserer Innenwelt aus einzelnen Elementen erschaffene Bild durch seine Wirkung für den Betroffenen rechtfertigen. Das Gehirn hat dabei zunächst einen engeren Rahmen als ein Maler, denn die Aufgabe des Organs unter unserer Schädeldecke besteht bekanntlich im biologischen Verständnis zunächst darin, die außen sichtbare Welt so zu rekonstruieren, daß man in ihr überleben kann. Doch bieten die malerischen Vorbereitungen die von unserer Wahrnehmung reichlich genutzte Möglichkeit, nicht nur ein wirklichkeitsnahes, sondern auch ein schönes Bild von der Welt zu bekommen.
Die Bilder im Kopf (»images«) entstehen also aus elementaren Formen, die in Hinblick auf das vorgegebene Ganze angeordnet werden, und genau diesen Vorgang nennt man Malen. Wie stark das Ganze dabei mitwirkt bzw. wie sehr die Erzeugung von ganzen Bildern zur Aufgabe des Gehirns gehört, erkennt man in der Neurophysiologie zum Beispiel bei der Analyse von Ausfallserscheinungen, die im Bereich der Sinne bzw. in einzelnen Abschnitte des Nervensystems auftreten können und in nicht zu schweren Fällen vom intakten Gehirn kompensiert werden.
Dieser Aspekt, der Schülern auch mit Hilfe des Blinden Flecks auf der Netzhaut vorgeführt wird, konnte schon vor der systematischen Beobachtung pathologischer Fälle erkannt werden, und zwar im Rahmen der Gestaltpsychologie, die nach einer kurzen Blütezeit in den frühen Jahrzehnten unseres Jahrhunderts lange Zeit übersehen oder gar vergessen wurde und erst in letzter Zeit wieder vermehrt Aufmerksamkeit bekommt. Die frühen Gestaltpsychologen wie Max Wertheimer, Wolfgang Köhler und Wolfgang Koffka haben damals auf die aktive »Organisationsleistung« des Gehirns hingewiesen, durch die unsere Wahrnehmung in der Lage ist, zeitlich, räumlich, formal oder materiell benachbarte Reizelemente (Teile der Wirklichkeit) so zusammenzufassen oder zu gruppieren, daß der Eindruck eines Ganzen – eines vollständigen Bildes – entsteht, das vom Bewußtsein als Gestalt erkannt und bezeichnet wird.[14] Die Bestrebung des Gehirns, in der sichtbaren Natur Gestalten auszumachen, ist so groß, daß man bekanntlich auch dort Gestalten – wie das Gesicht im Mond oder Profile in Wolken – erblickt, wo in Wirklichkeit keine sind. Inzwischen führt die Literatur verschiedene Gestaltgesetze an – zum Beispiel die Gesetze der Nähe, der Geschlossenheit, der Ähnlichkeit, der Durchgängigkeit und der Prägnanz –, die in wissenschaftlicher Form deutlich machen, daß die sinnliche Wahrnehmung der Wirklichkeit als aktiver und kreativer Vorgang dem Bewußtsein vollständig gestaltete Bilder liefert, mit dem das begriffliche Erkennen seinen Anfang nehmen kann. Die Ästhetik ist die Vorgabe für das Nachdenken, das nicht ohne Bilder in Aktion treten kann und immer auf das hier Gestaltete Bezug nehmen muß.
Ausgabe Nr. 22, Frühjahr 2023