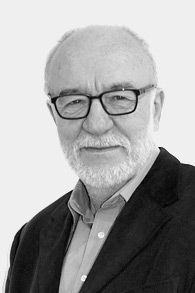Wer sich ernsthaft mit dem Begriff des Bildes beschäftigen und ihn sogar versuchsweise definieren möchte, ist gut beraten, mit Gemälden zu beginnen und einen Kunsthistoriker zu fragen, denn die malende Hervorbringung von Bildern gehört zu den frühen Kulturleistungen der Menschen. Vor einigen Jahren hat der Kunsthistoriker Gottfried Boehm ein Buch herausgegeben, in dem die und interessierende Frage, »Was ist ein Bild?«, im Titel gestellt wird.[12] Boehm weist dabei in seiner Einleitung darauf hin, daß niemand erwarten darf, auf diese einfach zu stellende Frage eine ebenso einfache Antwort zu finden, und er schreibt:
»Wer nach dem Bild fragt, fragt nach Bildern, einer unübersehbaren Vielfalt, die es fast aussichtslos erscheinen läßt, der wissenschaftlichen Neugier einen gangbaren Weg zu weisen. Welche Bilder sind gemeint: gemalte, gedachte, geträumte? Gemälde, Metaphern, Gesten? Spiegel, Echo, Mimikry? Was haben sie gemeinsam, das sich allenfalls verallgemeinern ließe? Welche wissenschaftlichen Disziplinen grenzen an das Phänomen Bild? Gibt es Disziplinen, die nicht daran grenzen?«
In der ersten Frage des Kunsthistorikers tauchen Bilder auf, die wir in der hier verwendeten Sprache am leichtesten als äußere und innere Bilder identifizieren können, und diese Unterscheidung soll in diesem Aufsatz eine besondere Betonung erfahren, und zwar deshalb, weil sie uns hilft, die Fährte des wissenschaftlichen Erkennens mit Bildern ausführlich zu verfolgen.
Um diesen Weg auf keinen Fall zu verpassen, muß der angesprochene Unterschied zwischen Innen und Außen so geklärt werden, daß ein vielfach begangener Irrtum nicht erneut vorkommt. Um es ganz deutlich zu sagen: Alle Bilder, die wir in diesem Buch sehen, sind äußere Bilder, selbst wenn sie Strukturen zeigen, die innerhalb von Körpern, Geweben oder Zellen zu finden sind. Mit »Innen« kann nur ein geistiges Innen gemeint sein, also ein Bereich, von dem es keine materiellen Photographien geben kann. Alles andere ist Außen, weil man die Körper öffnen und ihr Inneres nach außen wenden kann. Selbst das, was sich etwa im Inneren der Sonne abspielt oder im Inneren einer Zelle befindet, kommt nach außen, wenn man mit einer Sonde oder einer Elektrode eindringt, um zu messen, zu schauen, zu fotografieren und zuletzt die Ergebnisse in Form eines Bildes vor seinen Augen zu haben. So gut die Licht- und Elektronen-Mikroskope und andere bildgebende Verfahren mit vergrößernden Wirkungen auch sind, und so tief sie auch in das Innere der materiellen Welt eindringen, sie zeigen immer nur das, was durch den Eingriff veräußerlicht worden ist. Sie zeigen äußere Bilder des Inneren. Innere Bilder sehen wir auf diese Weise nicht. Sie müssen geträumt oder gedacht werden, wie Gottfried Boehm es oben ausdrückt, wobei seine Aufzählung natürlich nicht ganz vollständig ist. Tatsächlich läßt der Kunsthistoriker in seiner Einschätzung mehrere Bilder aus, und zwar sowohl die vielen Photographien als auch die noch zahlreicheren Fernsehbilder, die in einer Gesellschaft, die sich auf dem neuesten technischen Stand bewegen will und nach Informationen lechzt, weit verbreitet sind. Trotzdem gibt er schon einige der Aspekte vor, die eine Rolle spielen, wenn von den Erkenntnissen die Rede ist, die mit Bildern gelingen oder zumindest zusammenhängen. Das Malen von Bildern wird von vielen Künstlern tatsächlich als Quelle ihrer Erkenntnis verstanden und von der Kunstwissenschaft in diesem Sinne auch akzeptiert, worauf weiter unten eingegangen wird.
Möglicherweise läßt sich die Unterscheidung zwischen den inneren und äußeren Bildern durch die beiden Begriffe verdeutlichen, die der englischen Sprache für das eine deutsche Wort »Bild« zur Verfügung stehen, nämlich »picture« und »image«. Mit Hilfe dieser beiden englischen Begriffen läßt sich nämlich ein Unterschied festmachen, den es zu beachten gilt, wenn die Frage nach der Rolle der Bilder in der Forschung mehr meint als die Funktion von schmückenden Beigaben, die man als »mit fotografischen Mitteln erzeugte Abbildungen« definieren könnte:
Wer sich möglichst einfach ausdrücken will, könnte sagen, »pictures« sind Bilder, die man macht – etwa mit einer Kamera –, und »images« sind Bilder, die man sich macht – etwa mit seiner Einbildungskraft. (Wer die knappe Ausdrucksfähigkeit der englischen Sprache schätzt, kann verkürzt sagen, »pictures are taken«, und »images are made«). »Images« sind demnach innere Bilder, die mental erzeugt oder auf andere immaterielle Weise kreiert werden, und »pictures« sind äußere Bilder, die fotomechanisch oder auf andere technische Weise geliefert werden und in allen möglichen Formen von Kopien und Reproduktionen verfügbar sind.
Die hier anvisierte Unterscheidung könnte man auf der Ebene des Kunstschaffens auch auf die alte Diskussion anwenden, die wissen will, wann einer Photographie der Status einer Kunstwerks zuerkannt werden kann und man dem dabei entstandenen Bild den Rang zuspricht, der gewöhnlich Gemälden vorbehalten ist. Fotografische Aufnahmen können dann Kunstwerke werden, wenn man sie erst macht, nachdem man sie sich gemacht hat. »Pictures« können Kunst werden, wenn sie vorher »images« waren. Der amerikanische Landschaftsfotograf Ansel Adams hat dies gemeint, als er einmal die Bemerkung machte, das Schlimmste für ihn seien (technisch) gute Bilder von schlechten Konzepten.
Natürlich wird ein Foto niemals völlig den Charakter eines gemalten Bilder bekommen, und der Grund dafür liegt in seiner Herstellung, deren Beschreibung sich zunächst banal anhört, im folgenden Kapitel aber ihre Bedeutung bekommt. Wenn ein Bild gemalt wird, verlangt jede Einzelheit seiner Erscheinung – jeder Strich, jede Farbnuance, jeder Tupfer, jede Kleinigkeit – den konstruktiven Akt eines Künstlers. Das Gemälde, das wir als ein Ganzes erblicken, wird ausschließlich aus kleinen Details geschaffen, wobei der Maler natürlich die große Komposition (als »image«) vor Augen haben muß. Jede Linie muß ihren Ort in dem Bild haben, das zuletzt vor dem Betrachter erscheinen soll. Dieser Zusammenhang wird wichtig, wenn die inneren Bilder – die »images« – betrachtet werden, die das menschliche Gehirn zustande bringt.
Ausgabe Nr. 22, Frühjahr 2023